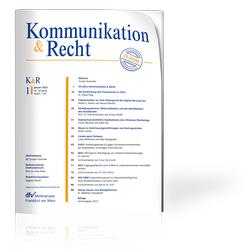Sehr geehrter Leser,
Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein,
um das Dokument der Zeitschrift
Kommunikation & Recht
zu lesen.
zum Login
Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen, dann können Sie die Zeitschrift sofort freischalten.
Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Kommunikation & Recht, um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen. Abonnement abschließen.
Die Fachpublikation Kommunikation und Recht (K&R) ist die monatliche Fachpublikation zu allen nationalen und internationalen Rechtsthemen mit Medienbezug. Im Fokus stehen: Wettbewerbs- und Markenrecht, Medien- und Presse- und Rundfunkrecht, Datenschutzrecht, Urheberrecht, E-Commerce, Computer-, Internetrecht und Telekommunikationsrecht. Praxisnahe Aufsätze und Kommentare anerkannter Branchenexperten, sowie ein hochaktueller Rechtsprechungsteil sind die besondere Stärke der Publikation.
Lesen Sie die K&R 4 Wochen
kostenlos und unverbindlich!
Zur Testphase
Telemedicus
13.10.2020 17:11
Die Telemedicus Sommerkonferenz findet digital und vom 19.-24. Oktober 2020 statt. Das Motto lautet „Digitale Regulierung 2020: Den Überblick behalten”. Wir freuen uns auf spannende Beiträge aus verschiedenen Rechtsgebieten – mal als Blogpost, mal als Videovortrag oder im Podcastformat!Speaker*innen und Themen
Montag, 19. Oktober 2020
Michael Naumann: Öffentlich-rechtliche Angebote auf Drittplattformen (Videovortrag)
Marc Liesching, Henner Hentsch: Regulierung des Jugendmedienschutz (Videopodcast)
Dienstag, 20. Oktober 2020
Simon Assion, Sarah Baumann: E-Privacy Verordnung: aktueller Stand und Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft (Podcast)
Margo Steiner: AI und Daten – Braucht man eine Regulierung über die DSGVO hinaus? (Videovortrag)
Insa Janssen, Patrizia Gufler, Johannes Schäufele: IoT – smart home | creepy home (Videovortrag)
Mittwoch, 21. Oktober 2020
Per Christiansen: Das Management von Content Moderatoren-Teams: Ein missing Link zum NetzDG(Videovortrag)
Markus Schröder: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten (Videovortrag)
Julia Holterhus: Eine Übersicht zum Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Videovortrag)
Donnerstag, 22. Oktober 2020
Hans-Christian Gräfe, Torben Klausa: Medienstaatsvertrag: Eine Übersicht (Blogbeitrag)
Jens Milker, Marco Holtz: Zulassungsfreiheit/Bagatellrundfunk (Interview)
Philipp Sümmermann: Neue Pflichten für Telemedien (Blogbeitrag)
Kerstin Liesem: Regulierung von Medienintermediären (Blogbeitrag)
Freitag, 23. Oktober 2020
Simon Assion: Telemedicus Workshop: Onlinejournalismus und Blogging (Workshop)
Alle Speaker und Telemedicus: Live Q&A – Session zu den Beiträgen der Soko20, Beginn: 17 Uhr (Videocall)
Samstag, 24. Oktober 2020
Telemedicus: Veröffentlichung Tagungsband Telemedicus Soko19 (Open Access Tagungsband)
Alle Beiträge werden an ihrem jeweiligen Veröffentlichungsdatum zum Abruf zur Verfügung stehen. Am Freitag, 23. Oktober, werden wir eine Live Q&A-Session veranstalten, bei der die Möglichkeit besteht, Fragen zu den Beitägen zu stellen.
Das aktuelle Programm gibt es hier zum Download. Die aktuelle Version ist auch auf unserem Twitter Account zu finden.
Telemedicus Workshop zum Onlinejournalismus und Blogging
Ziel des Workshops ist es, Fähigkeiten in den Bereichen des Onlinejournalismus und Blogging zu erwerben oder aufzufrischen. Dabei erhoffen wir uns, alte und neue Mitschreibende für Telemedicus zu aktivieren.
Die Eckdaten:
• Datum: Fr., 23.10.20 von 09:30 - 12:00 Uhr über Cisco WebEx.
• Leitung: Simon Assion, eines der Gründungsmitglieder von Telemedicus.
• Die Möglichkeit zur Anmeldung erfolgt nächste Woche in einem separaten Blogpost und auf Twitter.
11.10.2020 14:55
+++ EuGH: Pauschale Vorratsdatenspeicheurng nicht zulässig+++ LfDI BW verbietet Tübinger „Liste der Auffälligen”
+++ Gesetz gegen Hasskriminalität: Bundespräsident fordert Nachbesserung
+++ Bundesrat stimmt Gesetz gegen Abmahnmissbrauch zu
EuGH: Pauschale Vorratsdatenspeicheurng nicht zulässig
Der Europäische Gerichtshof hat die anlasslose Speicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten erneut für unvereinbar mit den Grundrechten auf Privatsphäre, Datenschutz und Meinungsfreiheit erklärt (Az. C-511/18). Eine pauschale Vorratsdatenspeicherung sei grundsätzlich unzulässig, entschied der EuGH. Allerdings billigt der Gerichtshof die generelle anlasslose Speicherung von IP-Adressen, die bei jeder Einwahl ins Internet neu vergeben werden. Darüber hinaus ist nach der Entscheidung die Speicherung etwa im Fall einer schwerwiegenden Bedrohung der nationalen Sicherheit zulässig. Das Urteil geht auf Verfahren zu Überwachungsgesetzen aus Frankreich, Belgien und Großbritannien zurück.
Zur Meldung in der taz.
Q&A zum Urteil bei netzpolitik.org.
LfDI BW verbietet Tübinger „Liste der Auffälligen”
Der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württemberg hat der Stadt Tübingen die Nutzung polizeilicher Daten für eine Liste „auffälliger“ Asylbewerber untersagt. In dieser „Liste der Auffälligen“ erfasste die Stadtverwaltung Daten von Asylbewerbern, die die Polizei im Zusammenhang mit Rohheitsdelikten erhoben hatte. Die Liste sollte dazu dienen, „städtische Bedienstete vor Übergriffen dieses Personenkreises zu schützen“. Die Daten waren auf der Grundlage ausländerrechtlicher Vorgaben erhoben worden. Sie für andere Zwecke an die Stadtverwaltung zu übermitteln, verstoße gegen den Zweckbindungsgrundsatz, so der LfDI. Konkrete Gefahren für Behördenmitarbeiter hätte die Stadt Tübingen zudem „weder im Einzelfall noch generell“ belegt.
Zur Pressemitteilung des LfDI BW.
Gesetz gegen Hasskriminalität: Bundespräsident fordert Nachbesserung
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat laut Süddeutscher Zeitung die Bundesregierung gebeten, das Gesetzespaket gegen Hasskriminalität zu überarbeiten. Sie solle Änderungen möglichst unverzüglich einarbeiten und einbringen, wie es in einem Schreiben des Bundespräsidialamts heißt. Bis dahin werde die Ausfertigung des Gesetzes ausgesetzt. Hintergrund sind verfassungsrechtliche Bedenken über den Zugriff des Bundeskriminalamts auf Bestandsdaten.
Mehr bei der Süddeutschen.
Bundesrat stimmt Gesetz gegen Abmahnmissbrauch zu
Der Bundesrat hat dem Gesetzentwurf gegen Abmahnmissbrauch zugestimmt. Mit der Reform sollen Anreize für Abmahngeschäftsmodelle gemindert werden. Mitbewerber sollen bei Verstößen gegen Kennzeichnungs- oder Informationspflichten – insbesondere nach Datenschutzrecht – keine Kosten mehr geltend machen können.
Zur Meldung bei heise.de.
04.10.2020 17:55
+++ EU-Parlament gegen Upload Filter+++ Datenschützer uneins über Nutzung von Microsoft 365
+++ DSGVO: 35,3 Mio EUR Bußgeld gegen H&M
+++ USA: Lösegeldzahlung bei Ransomware Infektion strafbar EU-Parlament gegen Upload Filter
In seinem Initiativbericht zum Digital Service Act (DSA) hat sich der Rechtsausschuss des EU-Parlaments vergangene Woche gegen Upload Filter ausgesprochen. Betreiber von Online Plattformen und sozialer Netzwerke sollten nicht allein über die Rechtmäßig- oder Rechtswidrigkeit von Inhalten entscheiden und diese unwidersprochen oder automatisiert löschen. Im Interesse der Meinungsfreiheit sollen Betroffene über Maßnahmen informiert werden und über nationale Streitbeilgegungsgremien die Möglichkeit erhalten, Rechtsmittel einzulegen. Provider sollen nicht zu privaten Hilfssheriffs werden, wie es derzeit in Deutschland unter dem Netzdurchsetzungsgesetz (NetzDG) der Fall ist. Auch soll es keine ex-ante Kontrollen geben, womit das Vorhaben im Widerspruch zu bereits beschlossenen Gesetzen im Kampf gegen Urheberrechtsverletzungen und terroristische Inhalte steht, die den Einsatz von Upload Filtern vorsehen. Die EU-Kommission hingegen plant mit dem DSA die Macht von Online Plattformen mit Mitteln des Wettbewerbsrechts zu beschneiden.
Zur Meldung (Upload Filter) auf heise.de.
Zur Meldung (Macht der Plattformen) auf heise.de.
Datenschützer uneins über Nutzung von Microsoft 365
Die Datenschutzbeauftragten der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland haben sich vergangene Woche von der Entscheidung der Datenschutzkonferenz (DSK) distanziert, wonach ein rechtskonfromer Einsatz von Microsoft 365 (früher „Office 365”) nicht möglich sei. Die Entscheidung über das bisher nicht veröffentlichte Papier war mit neun zu acht Stimmen denkbar knapp ausgefallen. In ihrer nun veröffentlichten gemeinsamen Erklärung kritisieren die Amtsleiter die Entscheidung als zu undifferenziert. Sie sehen in der Entscheidung lediglich eine „relevante Arbeitsgrundlage”, die u.a. mangels Anhörung von Microsoft aber noch nicht „entscheidungsreif” sei.
Zur gemeinsamen Erklärung der Landesdatenschutzbeauftragten.
Zur Meldung auf heise.de.
DSGVO: 35,3 Mio EUR Bußgeld gegen H&M
Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat der Hamburger Datenschutzbeauftrate ein Bußgeld über 35,3 Mio. Euro wegen Versößen gegen den Datenschutz gegen H&M verhängt. Das Unternehmen hatte in ihrem Nürnberger Servicecenter seit 2014 umfangreiche Profile über ihre Mitarbeiter angelegt, in denen Informationen zur Leistung mit persönlichen Informationen über den Gesundheitszustand und das Privatleben zusammengeführt wurden. Diese Informationen waren mitunter bis zu 50 Managern zugänglich. Aufgeflogen ist das ganze durch einen technischen Fehler, durch den diese Informationen für wenige Stunden unternehmensweit zugänglich waren.
Zur Pressemitteliung des HmbBfDI.
USA: Lösegeldzahlung bei Ransomware Infektion strafbar
Das US-Finanzministerium hat vergangene Woche eine Warnung veröffentlicht, dass sich Opfer von Ransomware-Infektionen selbst strafbar machen können, wenn sie der Lösegeldforderung nachkommen. Bei Ransomware werden Computersysteme verschlüsselt und für die Herausgabe des Keys zur Entschlüsselung Lösegeld („Ransome”) verlangt. In vielen Fällen gingen die Lösegeldzahlungen an Personen oder Länder, die auf Sanktionslisten stünden, so das US-Finanzministerium. In diesen Fällen müssten betroffene zunächst eine Genehmigung des Office of Foreign Assets Control (OFAC) einholen.
Zur Meldung auf heise.de.
01.10.2020 16:36
+++ 1. Oktober: Der Einfluss von KI auf die Weltgemeinschaft, digital+++ 1./2. Oktober: European Data Summit, Berlin/digital
+++ 1./2. Oktober: Verträge über digitale Inhalte und Dienstleistungen, digital
+++ 5. Oktober: Vertragsstrafen im IP- und Wettbewerbsrecht, Berlin/digital
+++ 12. Oktober: Geheimnisschutz vs. Presse- und Informationsfreiheit, digital
+++ 19.-25. Oktober: Telemedicus Sommerkonferenz 2020, digital
+++ 24.-30. Oktober: Medientage München, digital
+++ 27. Oktober: Safeguarding Freedom – Stabilising Democracy, digital
+++ 28. Oktober: Swipe for President, Berlin/digital
+++ 29. Oktober: Conference on New Media, Tech & Democracy, Boston/digital
+++ 29. Oktober: Internet der Dinge, digitale Transformation, Industrie, digital
Der Einfluss von KI auf die Weltgemeinschaft, digital
Die (Junge) deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik spricht mit Yvonne Hofstetter darüber, wie die Digitalisierung die Sicherheit und Stabilität in der Welt bedroht. Diskutiert werden soll etwa, welche Veränderungen durch selbstlernende Waffensysteme und Daten als Kriegsressource entstehen. Bestehende globale Sicherheitssysteme sowie die demokratische Ordnung würden damit unter Druck geraten. Welche politischen und völkerrechtlichen Antworten sich für die europäische und internationale Staatengemeinschaft ergeben, soll im Gespräch erörtert werden.
Termin: 1. Oktober, 18:00 Uhr
Wo: Junge DGPA München, digital via Zoom
Anmerkungen: Anmeldung für das Zoom-Meeting erforderlich.
Veranstaltungswebseite und Anmeldung.
European Data Summit, Berlin und digital
Die jährlich stattfindende Veranstaltung ist ein Expert*innentreffen von digitalpolitischen Entscheidungsträger*innen, Wettbewerbsökonom*innen und Vertreter*innen der Digitalwirtschaft. Der Slogan in diesem Jahr lautet "The Winner Takes It All". Das Motto verweist auf die Machtposition der großen digitalen Plattformen, die trotz vieler Kartellverfahren in den vergangenen Jahren eine unangefochtene Marktposition genießen. Telemedicus-Autor Sebastian Louven wird die Diskussion "When privacy meets competition" bereichern.
Termin: 30. September - 2. Oktober
Wo: Konrad-Adenauer-Stiftung, Livestream
Anmerkungen: Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.
Programm und Livestream.
Verträge über digitale Inhalte und Dienstleistungen, digital
Die Forschungsstelle für Verbraucherrecht an der Universität Bayreuth veranstaltet eine Konferenz zu digitalen Inhalten im Recht. Im Fokus steht die Umsetzung der Richtlinie 2019/770 über die Bereitstellung digitaler Inhalte. Diskutiert werden sollen die Auswirkungen auf das Schuldrecht im BGB. Daneben besteht Klärungsbedarf an den Grenzen zum Datenschutz- und Urheberrecht. Im zweiten Teil der Tagung werden die Auswirkungen der Neuregelung auf die Plattformen betrachtet: Welche vertragsrechtlichen Qualitätsanforderungen sind nun an diese Angebote zu stellen?
Termin: 1. und 2. Oktober
Wo: Universität Bayreuth, Online via Zoom
Anmerkungen: (Kostenpflichtige) Anmeldung erforderlich unter verbraucherrecht@uni-bayreuth.de.
Programm und Anmeldung.
Vertragsstrafen im Immaterial- und Wettbewerbsrecht, Berlin und digital
Für die GRUR-Bezirksgruppe Berlin hält Axel Metzger einen Vortrag zu Vertragsstrafen im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. Die Vertragsstrafe ist für die effektive Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen von erheblicher, da abschreckender, Bedeutung. Dabei darf sie jedoch nicht als Geschäftsmodell missbraucht werden. Dieses Spannungsfeld wird Metzger in seinem Vortrag analysieren. Abschließend soll auf die Auswirkungen des aktuellen „Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs“ kritisch eingegangen werden. Die Veranstaltung kann kostenfrei vor Ort sowie über eine Zoom-Konferenz verfolgt werden.
Termin: 5. Oktober, 18:00 Uhr.
Wo: Plenarsaal des Kammergerichts Berlin, Elßholzstraße 30-33, 10781 Berlin und Online via Zoom.
Anmerkungen: Anmeldung für Präsenzveranstaltung und Zoom-Call erforderlich.
Programm und Anmeldung.
Urheberrechtlicher Geheimnisschutz vs. Presse- und Informationsfreiheit, digital
Im Oktober findet das 2. Symposium des Forschungsinstitutes für Eigentum und Urheberrecht in der Demokratie statt. Drei voraufgezeichnete Beiträge sowie eine Live-Diskussion mit Arne Semsrott widmen sich dem Spannungsverhältnis von Urheberrecht und Informationsfreiheit. Zuletzt haben hier die Entscheidungen zu den „Afghanistan-Papieren“ sowie im Fall „Glyphosat-Gutachten“ gezeigt, dass das Urheberrecht für den Geheimnisschutz bemüht wird. Dem entgegen steht der Grundsatz der Informationsfreiheit, mit dem Medien und Private Zugang zu amtlichen Dokumenten erhalten. Neben der wissenschaftlichen Sicht werden in der Live-Diskussion die praktischen Herausforderungen bei IFG-Anfragen über fragdenstaat.de diskutiert.
Termin: 12. Oktober, 18:00 Uhr.
Wo: Humboldt Universität Berlin, Online
Anmerkungen: Anmeldung zur Live-Diskussion unter urheberrecht.demokratie.rewi@hu-berlin.de.
Veranstaltungswebseite und Anmeldung.
Telemedicus Sommerkonferenz 2020
Ob Blogbeiträge, Podcasts oder Videovorträge: Die Formate unserer Soko20 werden vielfältig. Wir werden die Beiträge in der Woche vom 19. - 24. Oktober 2020 veröffentlichen. Am Freitag, 23. Oktober 2020, planen wir am Nachmittag bis in den Abend eine Live-Session (ggf. mit einem virtuellen Get-Together). Den Nachmittag des 23. Oktober 2020 solltet Ihr Euch also auf jeden Fall vormerken!
Die bisher gesetzten Themen sind in den Bereichen Medienstaatsvertrag, NetzDG, e-Privacy/ TTDSG, Öffentlich-rechtliche Angebote auf Drittplattformen, Jugendmedienschutz, Digital Single Market, Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, Informationsfreiheitsgesetz angesiedelt. Das genaue Programm versöffentlichen wir rechtzeitig auf dem Blog.
Termin: Beiträge vom 19.-25. Oktober, Live-Gespräch mit den Autor*innen am 23. Oktober
Wo: Telemedicus.info
Anmerkungen: Anmeldungen zum Live-Gespräch an j.kunze[at]telemedicus.info.
Programm der digitalen Konferenz.
Medientage München, digital
Die Medientage München sind die zentrale Plattform für alle Trends und Debatten in der deutschen Medienwelt. In diesem Jahr findet das Format auf der eigenen digitalen Plattform statt. Neben Vorträgen und Diskussionen werden digitale Masterclasses und Workshops angeboten. Eine Woche lang gibt es in den Livestrams Musik, Podcasts und Gespräche zu den Bereichen Fernsehen, Audio, Streaming und Co. Auch aktuelle politische Diskussionen etwa zur Plattformregulierung werden aufgegriffen, u.a. im Europatags-Panel. Das Programm verspricht eine vielfältige Woche.
Termin: 24.-30. Oktober
Wo: Digitale Plattform
Anmerkungen: Die Veranstaltung ist kostenpflichtig.
Programm und Tickets.
Safeguarding Freedom – Stabilising Democracy
Die deutschen Medienanstalten veranstalten ein öffentliche Digital-Konferenz. Im Kern wird es darum gehen, wie die freiheitliche Demokratie online gesichert werden kann. Zwei europäische Initiativen, die DSM-RL sowie der European Democracy Action Plan, bieten Anlass zur Diskussion. Welche Regeln hier sinnvoll implementiert werden könnten, wird an einem Nachmittag in den Abschnitten Desinformation und Online-Rechtsdurchsetzung besprochen.
Termin: 27. Oktober, 13:30 Uhr
Wo: Medienanstalten, Online
Anmerkungen: Kostenfreie Anmeldung erforderlich. Die Veranstaltungssprache ist Englisch.
Programm und Anmeldung.
Swipe for President, Berlin und digital
Vor dem Hintergrund der US-Präsidentschaftswahlen diskutiert der Digitale Salon des HIIG die Vor- und Nachteile von digitalen Abstimmungen. Katja Weber moderiert den Abend. Eine Teilnahme ist sowohl im Stream als auch vor Ort möglich.
Termin: 28. Oktober, 19:00 Uhr.
Wo: Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, Französische Straße 9, 10117 Berlin und Online im Stream.
Anmerkungen: Veranstaltung findet statt in der Veranstaltungsreihe Digitaler Salon.
Programm, Stream und Anmeldung.
Conference on New Media, Tech & Democracy, Boston (US) und digital
Die Tuffs Universität in Boston veranstaltet eine Online-Konferenz zu New Media, Technik & Democracy. Neben dem Dauerthema des schwindenden Vertrauens in die Medien wird ein vergleichender Blick auf US/EU-Online-Inhalteregulierung geworfen. Weiteres Panel-Thema sind die Verantwortung der Plattformen für die Information der Bevölkerung zu Covid-19 unter dem Stichwort "Infodemic". Abschließend sollen digitale Gefahren und Möglichkeiten für (US-)Wahlen analysiert werden.
Termin: 29. Oktober
Wo: Tufts Universität, Online
Anmerkungen: Anmeldung erforderlich. Veranstaltungssprache ist Englisch.
Programm und Anmeldung.
Internet der Dinge, digitale Transformation, Industrie
Telemedicus-Autor Simon Assion behandelt in seinem Online-Vortrag aktuelle Problemstellungen und Fragen zum "Internet der Dinge" im Datenschutzrecht und rund um das sogenannte Dateneigentum. Er geht praxisbezogen insbesondere auf Vertragsgestaltung und Compliance von Produkten und Abläufen ein.
Termin: 29. Oktober, 10:00 Uhr.
Wo: Deutsche Anwalt Akademie, Online.
Anmerkungen: Anmeldung kostenpflichtig.
Programm und Anmeldung.
Sollten Sie Ihre Veranstaltung hier nicht wiederfinden, obwohl sie einen Bezug zu den Themenbereichen Informations-, Urheber- & Medien- oder Datenschutzrecht aufweist, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.
27.09.2020 20:17
+++ Bundeskabinett beschließt Entwurf zur Bürger-Identifikationsnummer+++ Grüne fordern Überarbeitung des Gesetzesentwurfs gegen Hasskriminalität
+++ USA: Streit um TikTok geht weiter
+++ Facebook warnt vor Folgen im Streit mit der irischen Datenschutzbehörde Bundeskabinett beschließt Entwurf zur Bürger-Identifikationsnummer
Das Bundeskabinett hat vergangene Woche den Entwurf eines Registermodernisierungsgesetz beschlossen. Danach soll die Steuer-Identifikationsnummer künftig als zentrale Personenkennziffer dienen und den Austausch personenbezogener Daten verschiedener Bereiche der Verwaltung erleichtern und die Datenqualität verbessern. In einem „Datencockpit” sollen Bürger einsehen können, welche Behörden auf Grundlage der Steuer-ID Daten ausgetauscht haben. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hatte im Vorfeld verfassungsrechtliche Bedenken gegen den Gesetzes-Entwurf für ein registerübergreifendes Identitätsmanagement geäußert. Der Gesetzesentwurf sehe kein ausdrückliches Verbot vor, auf Grundlage der Steuer-ID Persönlichkeitsprofilen zu bilden. Weiterhin erhöhe die Speicherung der Steuer-ID in allen angeschlossenen Registern die Gefahr von „Tracing“. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber äußert Bedenken. Mit einer Bürger-Identifikationsnummer könne der Staat ein umfassendes Persönlichkeitsprofil erstellen. Die Bewertung des Profils könne dann von allen vorgenommen werden, die Zugriff haben. Das würde zu Missbrauch und Fehleinschätzungen führen.
Zur Meldung bei LTO.
Zur Meldung bei heise.
Zur Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes.
Grüne fordern Überarbeitung des Gesetzesentwurfs gegen Hasskriminalität
Die Bundestagsfraktion hat vergangene Woche die Überarbeitung des bereits verabschiedeten Gesetzesentwurfs gegen „Rechtsextremismus und Hasskriminalität“ gefordert. Viele Punkte des Gesetzesentwurfs seien bereits im Vorfeld auf heftige Kritik gestoßen. Bereits letzte Woche hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) die Unterzeichnung des Gesetzesentwurfs verweigert. Auf Grundlage eines Rechtsgutachtens von Prof. Dr. Matthias Bäcker fordern nun die Grünen eine neue, verfassungskonforme Überarbeitung des Gesetzes. Besonders die Meldepflicht und Übermittlung von Bestandsdaten sozialer Netzwerke an das BKA müsse evaluiert werden. Die Grünen sprechen sich für einen Datentransfer in zwei Schritten aus: Zunächst soll das BKA nur den gemeldeten Inhalt erhalten. Erst bei einem bestätigtem Verdacht sollen dann die Bestandsdaten, wie IP-Adressen übermittelt werden. Dafür soll das soziale Netzwerk die Bestandsdaten nach Meldung an das BKA eine Woche speichern. Die Betroffenen müssten außerdem über den Datentransfer informiert werden. Nur so könne man das Gesetz in Einklang mit dem Grundgesetz bringen.
Zur Meldung bei heise.
Zum Rechtsgutachten.
USA: Streit um TikTok geht weiter
Die US-Regierung hat am Freitag Unterlagen zur Begründung eines Verbots der App TikTok in den USA vor einem Gericht in Washington eingereicht. Die USA werfen den Betreibern von TikTok vor, die Daten von Nutzern auch der chinesischen Regierung zur Verfügung zu stellen. TikTok versichert, dass Daten von US-Bürgern nur in den USA gespeichert werden und chinesische Behörden darauf nicht zugreifen können. Die Begründung, warum die US-Regierung trotzdem ein Risiko sieht, sind in der öffentlichen Fassung des nun eingereichten Dokuments allerdings geschwärzt. Das Gericht in Washington hat eine Anhörung von TikTok für den heutigen Sonntag angesetzt. TikTok wirft den USA vor, die App als politisches Druckmittel für die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China zu missbrauchen. Auf Drängen von US-Präsident Trump hatte sich TikTok bereits auf einen „Deal” mit den US-Unternehmen Oracle und Walmart eingelassen, wonach zumindest Teile der App auf ein geplantes Gemeinschaftsunternehmen übergehen sollen. Die Einzelheiten sind jedoch noch unklar.
Zur Meldung bei heise.
Mehr bei Zeit online.
Facebook warnt vor Folgen im Streit mit der irischen Datenschutzbehörde
Facebook hat vergangene Woche in einer Stellungnahme vor den Folgen gewarnt, wenn Datentransfers in die USA künftig nicht mehr möglich sein sollen. Der irische High-Court überprüft momentan eine Anordnung der irischen Datenschutzbehörde, die Facebook den Transfer personenbezogener Daten von EU-Bürgern in die USA auf Grundlage der Schrems II-Entscheidung des EuGH untersagt. Facebook warnt, dies sowohl auf Facebook als auch auf Instagram erhebliche Folgen haben würde. In einer eidesstattlichen Versicherung für das Gericht, wirft Facebook dabei auch Zweifel auf, ob die beiden Plattformen im Fall einer vollständigen Untersagung überhaupt noch in der EU betrieben werden könnten. Facebook hat zwischenzeitlich aber auch klargestellt, keineswegs einen Rückzug aus Europa zu planen.
Zur Meldung bei golem.
20.09.2020 16:01
+++ Bundespräsident zögert bei Hate-Speech-Gesetzespaket+++ US-Regierung schiebt TikTok-Bann auf
+++ Urheberrecht: Neuer Referentenentwurf zur DSM-Richtlinie
+++ EuGH zur Netzneutralität bei gedrosselten Tarifen
+++ Irisches Gericht bremst Datenschutzbehörde gegen Facebook
+++ BVerwG: Insolvenzverwalter hat keinen Auskunftsanspruch nach DSGVO
Bundespräsident zögert bei Hate-Speech-Gesetzespaket
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält beim jüngsten Gesetzespaket gegen Hate Speech seine Unterschrift zurück. Das berichteten die SZ, der NDR und der WDR am Freitag. Steinmeier habe die Sorge, dass das im Juni beschlossene „Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität“ teilweise verfassungswidrig sein könnte: Das Bundeskriminalamt bekomme möglicherweise zu weite Zugriffsrechte auf Daten von Nutzern Sozialer Netzwerke, die künftig bestimmte Straftaten ihrer Nutzer melden müssen. Das Bundesverfassungsgericht hatte erst in diesem Jahr den staatlichen Zugriff auf Bestandsdaten von TK-Providern als zu unbestimmt beanstandet. Innen- und Justizministerium bitten Steinmeier laut SZ, zu unterschreiben – dann „schiebe man gleich ein Reparaturgesetz hinterher“. Ohne die Unterschrift des Bundespräsidenten kann das Gesetz nicht in Kraft treten.
Zum Bericht der SZ.
US-Regierung schiebt TikTok-Bann auf
Google und Apple müssen die App des Kurzvideo-Dienstes TikTok nun doch nicht aus ihren App Stores werfen. Die US-Regierung hat den am Freitag für heute (Sonntag) angeordneten Downloadstopp um mindestens eine Woche verschoben. US-Präsident Trump hatte befürchtet, dass Daten von Nutzern aus den USA mit chinesischen Behörden geteilten werden könnten. Nun sollen sich Oracle und Walmart an TikTok beteiligen; Oracle soll künftig alle Daten von US-Nutzern verarbeiten und die technische Infrastruktur dafür stellen. Der Deal hat die Bedenken des US-Präsidenten nun offenbar ausgeräumt. Eine entsprechende Anordnung zur chinesischen Messenger-App WeChat hält die US-Regierung aber offenbar aufrecht (Stand: Sonntag 11:00 Uhr).
Mehr in der Zeit.
Urheberrecht: Neuer Referentenentwurf zur DSM-Richtlinie
Zur Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie für den Digitalen Binnenmarkt (DSM-RL) kursiert laut Presseberichten ein Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium (BMJV). Danach soll die Umsetzung in einem Gesetzespaket erfolgen, anders als bisher geplant. Aus dem Entwurf ergeben sich einige Änderungen. Bei der neuen Providerhaftung für Upload-Plattformen soll die Möglichkeit der lizenzfreien „Bagatelluploads“ offenbar bleiben, das Pre-Flagging von erlaubten Uploads mit fremden Inhalten nun aber doch nicht kommen. Im Presse-Leistungsschutzrecht sollen Überschriften dem Entwurf zufolge nicht lizenzfrei sein. Im Januar und Juli hatte das BMJV Diskussionsentwürfe zur Umsetzung veröffentlicht und zahlreiche Stellungnahmen erhalten.
Mehr bei Golem.
EuGH zur Netzneutralität bei gedrosselten Tarifen
Mobilfunkprovider dürfen nicht bestimmte Anwendungen und Dienste zum „Nulltarif“ anbieten, die Nutzung der übrigen Anwendungen und Dienste dagegen blockieren oder verlangsamen. Das stellt einen Verstoß gegen die Netzneutralität dar, die eine EU-Verordnung festlegt. Das hat der EuGH entschieden (Az. C-807/18 und C-39/19). Mobilfunkanbieter dürfen also nicht bestimmte Dienste wie Spotify oder Netflix von Drosselungen ausnehmen, sobald das Datenvolumen aufgebraucht ist. Der Fall geht auf eine Vorlagefrage aus Ungarn zurück.
Zur Pressemitteilung des EuGH.
Irisches Gericht bremst Datenschutzbehörde gegen Facebook
Facebook muss den Datentransfer in die USA zunächst einmal nicht stoppen und darf sich vorerst weiter auf die Standardvertragsklauseln berufen. Der irische High Court hat eine vorläufige Anordnung der irischen Datenschutzbehörde gegen Facebook gekippt. Facebook kann so die Anordnung gerichtlich überprüfen lassen und darf erst einmal weiterhin Daten in die USA übertragen. Facebook nutzt hierfür wie viele andere US-Plattformen die Standardvertragsklauseln, nachdem der EuGH im Juli das Privacy Shield gekippt hatte.
Zur Meldung bei Golem.
BVerwG: Insolvenzverwalter hat keinen Auskunftsanspruch nach DSGVO
Ein Insolvenzverwalter hat nach Datenschutzrecht keinen Anspruch auf Auskunft über das Steuerkonto eines Insolvenzschuldners. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Az. 6 C 10.19). Im konkreten Verfahren klagte der Insolvenzverwalter in seiner Funktion gegen das Finanzamt und verlangte einen Auszug aus dem Steuerkonto des Schuldners, um potentiell anfechtungsrelevante Sachverhalte zur Mehrung der Insolvenzmasse zu ermitteln. Er stützte sein Auskunftsverlangen auf Art. 15 DSGVO. Ohne Erfolg: Ein Insolvenzverwalter sei hinsichtlich der personenbezogenen Daten des Insolvenzschuldners weder nach dem Wortlaut, der Systematik noch nach dem Sinn und Zweck der einschlägigen Regelungen der DSGVO „betroffene Person“, so das BVerwG. Der Anspruch sei „seiner Natur nach ein Instrument zur Schaffung des notwendigen Wissensfundaments für die Geltendmachung weitergehender Betroffenenrechte und zielt nicht auf die vom Kläger beabsichtigte Gewinnung von Informationen mit vermögensrechtlichem Bezug“, heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts.
Zur Pressemitteilung des BVerwG.
Niko Härting kommentiert das Urteil bei LTO.
14.09.2020 09:42
Großes Update zur diesjährigen Telemedicus Sommerkonferenz: Dieses Jahr wird die Soko20 nicht nur verspätet, sondern auch digital und findet vom 19. - 24. Oktober 2020 statt. Unser Motto lautet „Digitale Regulierung 2020: Den Überblick behalten”.Die Motivation und das Konferenzmotto
Wir haben in den letzten Wochen sehr lange und intensiv diskutiert, ob und wie wir die Soko20 stattfinden lassen sollen. Denn in Zeiten erhöhter Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona ist eine Soko in gewohnter Weise nicht realisierbar. Gleichzeitig wird aus unserem eigenen Umfeld deutlich, dass unser Konferenzmotto „Digitale Regulierung 2020: Den Überblick behalten” aktuell ist und der Austausch und die Diskussion gesucht wird.
Darum wollen wir die Soko20 nicht ausfallen lassen und allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich einen Überblick der aktuellen und zukünftigen Regulierung zu verschaffen. Die bisher gesetzten Themen sind in den Bereichen:
• Medienstaatsvertrag
• NetzDG
• e-Privacy/ TTDSG
• Künstliche Intelligenz
• Öffentlich-rechtliche Angebote auf Drittplattformen
• Jugendmedienschutz
• Digital Single Market
• Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
• Datensicherheit bei IoT-Geräten
• Informationsfreiheitsgesetz
Ein separater Beitrag mit den Speakern und Themen folgt in den nächsten Tagen.
Wer ein weiteres wichtiges Thema der digitalen Regulierung in unserem Themenkatalog nicht wieder findet, ist ausdrücklich eingeladen, einen Hinweis oder Beitragsvorschlag an soko20@telemedicus.info zu senden.
Die Soko20 wird digital
Ob Blogbeiträge, Podcasts oder Videovorträge: Die Formate unserer Soko20 werden vielfältig. Wir werden die Beiträge in der Woche vom 19. - 24. Oktober 2020 veröffentlichen. Am Freitag, den 23. Oktober 2020 planen wir am Nachmittag bis in den Abend eine Live-Session (ggf. mit einem virtuellen Get-Together). Den Nachmittag des 23. Oktober 2020 solltet Ihr Euch also auf jeden Fall vormerken!
Ein großes Dankeschön an Speaker, Partner und Sponsoren
Obwohl wir die gesamte Soko auf digitale Formate umgestellt haben, sind uns die meisten unserer bereits geplanten Speaker treu geblieben und haben eine digitale Variante ihres Beitrags zugesagt. Wir wissen, dass dies nicht selbstverständlich ist und bedanken uns bei unseren Speakern, die trotz der neuen Umstände so flexibel und motiviert sind, um einen hochkarätigen Beitrag zur Soko20 zu leisten.
Ein ebenso großes Danke geht an unsere langjährigen Sponsoren, die uns auch dieses Jahr unterstützen. Wir bedanken uns ausdrücklich bei Bird & Bird, dem game-Verband, HÄRTING Rechtsanwälten und SKW Schwarz. Zudem ist das Weizenbaum-Institut (Forschungsgruppe RIoT) wieder Mitveranstalter.

Teilen und weitersagen
Unsere Planung läuft und wir werden Neuigkeiten nun in kürzeren Abständen veröffentlichen. Damit auch die diesjährige Soko so erfolgreich wie immer wird, bleibt nur noch der Aufruf an alle: Den Termin am 23.10. freihalten und die Neuigkeiten weitersagen!
P.S.: Wer uns die kreativste Ausrede schickt, warum die Sommerkonferenz im Oktober stattfindet, gewinnt einen Preis (Rechtsweg ausgeschlossen).
13.09.2020 21:16
+++ Bundestag beschließt Gesetz gegen Abmahnmissbrauch+++ EDSA: Guidelines zu Auftragsverarbeitung und Social Media
+++ BGH: Erben haben Anspruch auf Zugriff auf Facebook-Account
+++ Bundesregierung: Schärferes Kartellrecht gegen Digitalkonzerne
+++ Generalanwalt: Inline-Linking nur mit Erlaubnis zulässig
Bundestag beschließt Gesetz gegen Abmahnmissbrauch
Der Bundestag hat vergangene Woche ein neues „Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs” beschlossen, mit dem Abmahnmissbrauch eingedämmt werden soll. Insbesondere soll bei wettbewerbsrechtlichen Bagatellverstößen – wie Verletzungen bloßer Informationspflichten – kein Anspruch auf Erstattung von Anwaltskosten für die Abmahnung mehr bestehen. Zudem sieht das Gesetz Regelbeispiele vor, wann eine Abmahnung als missbräuchlich angesehen werden soll, z.B. im Fall von Massenabmahnungen. Auch der sog. „fliegende Gerichtsstand” soll eingeschränkt werden: Bei Wettbewerbsverletzungen im Internet soll künftig nur noch das Gericht am Sitz des Beklagten zuständig sein.
Die Details bei Heise online.
Zur Pressemeldung des BMJV.
EDSA: Guidelines zu Auftragsverarbeitung und Social Media
Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat vergangene Woche zwei Richtlinien (Guidelines) zur Abgrenzung von Auftragsverarbeitung und Verantwortlichkeit sowie zum Tracking von Nutzern in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Bis zum 19. Oktober können Interessierte zu den Guidelines Stellungnahmen einreichen. Die Guidelines sind aktuell nur auf Englisch verfügbar.
Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor.
Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users.
BGH: Erben haben Anspruch auf Zugriff auf Facebook-Account
Erben haben Anspruch auf Zugang zu Social Media-Accounts von des Erblassers. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) vergangene Woche noch einmal bekräftigt (Az. III ZB 30/20). Schon 2018 hatte der BGH entschieden, dass Facebook den Erben Zugang zu den Daten des entsprechenden Accounts gewähren muss. Facebook hatte den Erben daraufhin einen USB-Stick mit einer umfassenden PDF-Datei von über 14.000 Seiten übersandt. Dies genüge jedoch nicht, so der BGH jetzt. Vielmehr müsse nicht nur Zugriff auf die in dem Account hinterlegten Daten gewährt werden. Der Account müsse vielmehr selbst auf dieselbe Art und Weise zur Verfügung gestellt werden, wie er ursprünglich vom Erblasser genutzt werden konnte.
Zur Pressemeldung des BGH.
Bundesregierung: Schärferes Kartellrecht gegen Digitalkonzerne
Das Bundeskabinett hat vergangene Woche eine Novelle des Kartellrechts beschlossen, mit der die Marktmacht großer Digitalkonzerne in Deutschland beschränkt werden soll. Danach soll das Bundeskartellamt bereits dann regulierend eingreifen können, wenn zwar keine marktbeherrschende Stellung, aber eine „überragende marktübergreifende Bedeutung” vorliegt. Zudem sieht das Gesetz Zugangs- und Übertragungsansprüche für Daten auf Digitalplattformen vor. Zugleich sollen mittelständische Unternehmen entlastet werden, indem die Schwellwerte für Fusionskontrollen erhöht werden.
Hintergründe bei faz.net.
Weitere Details bei Heise online.
Generalanwalt: Inline-Linking nur mit Erlaubnis zulässig
Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) Maciej Szpunar hat vergangene Woche seine Schlussanträge in einem weiteren Verfahren um die urheberrechtliche Zulässigkeit sog. Inline-Links entschieden. Bereits in einer ganzen Reihe von Verfahren hat sich der EuGH mit der Frage beschäftigt, inwiefern verschiedene Formen von Links im Internet urheberrechtlich relevant sind. Dabei entschied der EuGH im Jahr 2014, dass die „Einbettung” von Inhalten als Frame in eine Webseite keine urheberrechtliche Nutzung darstelle. Der Generalanwalt fordert nun eine Abkehr von dieser Rechtsprechung: In der Entscheidung seien „bestimmte tatsächliche Umstände nicht berücksichtigt worden”, die „zu einer anderen Entscheidung in dieser Rechtssache hätten führen müssen”. Jedenfalls seien aber Inline-Links, also die automatische Einbindung von Inhalten in die Webseite (z.B. per HTML-img-Tag) anders zu beurteilen als Frames und es liege daher eine urheberrechtlich relevante Nutzung vor.
Details bei LTO.
01.09.2020 11:20
+++ 7./8. September: Regulierung für Algorithmen, Online+++ 9.-13. September: Ars Electronica, Linz sowie Online
+++ 10. September: Digitale DSRI-Herbstakademie, Online
+++ 21.-23. September: Wein und Recht, Würzburg
+++ 22. September: Chancen der Anonymisierung, Online
+++ 23.-25. September: EDV-Gerichtstag, Online
+++ 28./29. September: Bitkom Privacy Conference, Online
Regulierung für Algorithmen, Online
Die Vereinigung für das gesamte Regulierungsrecht veranstaltet unter der Leitung von Daniel Zimmer die Tagung "Regulierung für Algorithmen". An zwei Tagen kommen viele Stimmen aus der Wissenschaft zu Wort. Regulierung von Algorithmen ist derzeit auf der politischen Agenda intensiv vertreten. Mehrere Bundestags- und Regierungskomissionen erarbeiten derzeit Empfehlungen an die Politik. Die Tagung soll nun die wissenschaftliche Perspektive vertiefen. Die Beiträge behandeln die Regulierung von Algorithmen bezüglich KI, Meinungsblasen, Transparenz, Finanzhandel und Kartellrecht sowie im Strafrecht. BfdDI Ulrich Kelber wird am Montagabend eine Keynote halten.
Die Veranstaltung findet via Zoom statt. Eine kostenfreie Anmeldung ist erforderlich.
Termin: 7./8. September
Wo: Universität Bonn, Online via Zoom
Anmerkungen: Zugleich Mitgliederversammlung der Gesellschaft für das gesamte Regulierungsrecht.
Programm und Anmeldung.
Ars Electronica, Linz
Die Ars Electronica ist ein Festival für Kunst, Technik und Gesellschaft. In diesem Jahr findet die Schau sowohl in Linz, Online als auch in 120 weiteren Städten statt, sodass jeder Erdenbürger einen Veranstaltungsort in der Nähe hat. Unter dem Slogan "In Keplers Garden" geht es inhaltlich um die vier Themengebiete Autonomy – Democracy, Ecology – Technology, Humanity & Uncertainty. Das künstlerische Programm wird laufend aktualisiert und ist auf der Festivalwebseite einsehbar.
Termin: 9.-13. September
Wo: JKU Campus, Linz und 120 Orte weltweit
Anmerkungen: Buchung einer Führung vor Ort möglich. Veranstaltungen in Deutschland uA in Bremen, Potsdam, Berlin, Karlsruhe, Dresden.
Weitere Informationen und Online-Festival.
Digitale DSRI-Herbstakademie, Online
Die DSRI-Herbstakademie ist fester Bestandteil der Konferenzlandschaft im Daten- und IT-Recht und wird maßgeblich durch engagierte Anwältinnen gestaltet. Die vielfältigen Vorträge werden in diesem Jahr aufgezeichnet bereitgestellt. Ab dem 10. September können die rund 70 Beiträge abgerufen werden. Ein Zugangscode kann auf der DSRI-Webseite erworben werden. Am 09./10. September um 19 Uhr finden Online-Diskussionen zu "Corona als Beschleuniger der Digitalisierung?" und "Umgang mit IT-Katastrophen" statt.
Termin: Ab 10. September
Wo: Online
Anmerkungen: Zugang zu den digitalen Inhalten auf der DSRI-Webseite erhältlich.
Veranstaltungswebseite.
Wein und Recht, Würzburg
Statt Segeln & Recht gibt es das beliebte IT-Rechtsseminar in diesem Jahr als Wein & Recht Edition. Unter den Dozenten ist auch Telemedicus-Redakteur Hans-Christian Gräfe. Das Seminar kann durch Selbststudium der Telemedicus-Newsletter noch um fünf Fachanwaltsfortbildungsstunden verlängert werden.
Termin: 21.-23. September
Wo: Würzburg
Anmerkungen: Anmeldung erforderlich. Aktuelle Informationen direkt beim Veranstalter erfragen.
Weitere Informationen und Anmeldung.
Chancen der Anonymisierung, Nürnberg
Das Museum für Kommunikation in Nürnberg veranstaltet regelmäßig den "Daten-Dienstag". Im September findet er als digitale Ausgabe statt. Im Gespräch ist der Vorsitzende der Stiftung Datenschutz, Frederick Richter. Er wird berichten welche Möglichkeiten die Anonymisierung bietet und was das mit der Corona-App zu tun hat. Der Vortrag wird via Zoom stattfinden.
Termin: 22. September
Wo: Museum für Kommunikation, Nürnberg, Online via Zoom
Anmerkungen: Anmeldung kostenfrei, aber erforderlich.
Weitere Informationen und Anmeldung.
EDV-Gerichtstag, Online
Der EDV-Gerichtstag findet bereits in der 29. Edition statt. Nun zum ersten Mal rein digital und dies ist auch Programm: "Digitalisierung grenzenlos - aber (nur) mit Sicherheit". Die Veranstaltung befasst sich breit mir vielen Themen um digitales Recht vor Gericht. So geht es um Sicherheit der IT-Systeme der Gerichte, also auch um E-Government und KI in der Justiz.
Termin: 23.-25. September
Wo: Online
Anmerkungen: Anmeldung kostenfrei, aber erforderlich.
Anmeldung und nähere Informationen.
Bitkom Privacy Conference, Online
Auch die hochkarätig besetze Bitkom Privacy Konferenz findet in diesem Jahr ausschließlich digital & kostenfrei statt. Im Mittelpunkt stehen die neuesten Entwicklungen im Datenschutz- und IT-Recht. Zu Wort kommen am Montagabend und Dienstag uA BfdDI Ulrich Kelber, EU-Justiz-Komissar Didier Reynders, Peter Fleischer & Sharon Marshall von Google, Jonathan S. Kallmer von Zoom und Anna Morgan von der in der Kritik stehenden irischen Datenschutzbehörde. Die Privacy Conference ist damit eine internationale Gesprächsplattform. Neben den Vorträgen soll es auch digital Raum zur Vernetzung geben. Die Anmeldung zur normalerweise hochpreisigen Konferenz ist in diesem Jahr kostenfrei.
Termin: 28.-29. September
Wo: Online
Anmerkungen: Anmeldung kostenfrei, aber erforderlich.
Anmeldung und nähere Informationen.
Sollten Sie Ihre Veranstaltung hier nicht wiederfinden, obwohl sie einen Bezug zu den Themenbereichen Informations-, Urheber- & Medien- oder Datenschutzrecht aufweist, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.
30.08.2020 18:52
+++ BRAK warnt vor falschem beA-Sicherheitsupdate+++ DSGVO: Bundesländer schließen Vereinbarung nach Art. 26
+++ BMI: Steuer-ID als Bürgernummer
+++ Streit um App-Store Provisionen spitzt sich zu
+++ VG Berlin: BMI muss Einsicht in Twitter Chats gewähren
+++ TikTok reicht Klage gegen US-Regierung ein
+++ LfDI BW veröffentlicht Orientierungshilfe zu internationalen Datenverkehr
BRAK warnt vor falschem beA-Sicherheitsupdate
Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) warnt vor Falschmeldungen zum kommenden Sicherheitsupdate der Client Software des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA), die derzeit via E-Mail zirkulieren. Die BRAK wird am 03.09.2020 auf ihrer Webseite ein Update der beA Client-Security zum Download bereitstellen und warnt davor, andere nicht-vertrauenswürdige Quellen oder Links zu verwenden.
Zur Warnmeldung der BRAK.
Weitere Informationen der BRAK zum Sicherheitsupdate des beA Client.
DSGVO: Bundesländer schließen Vereinbarung nach Art. 26
Im Zusammenhang mit dem Inkraftreten der neuen Vorschriften zum Nationalen Waffenregister (NWR) findet sich in der Parlamentsdokumentation des Landtages NRW der Entwurf einer Vereinbarung gem. Art. 26 DSGVO über die Verarbeitung personenbezogener Daten von Waffenhändlern und -herstellern in der Kopfstelle des nationalen Waffenregisters. Die Bundesländer beauftragen somit als gemeinsam Verantwortliche einen Dienstleister mit der Verarbeitung der Daten im Auftrag.
Zum Entwurf einer Vereinbarung gem. Art. 26 DSGVO.
Ausführlich auf De Lege Data.
BMI: Steuer-ID als Bürgernummer
Das Bundesinnenministerium (BMI) plant in einem Referentenentwurf (RefE) zur „Einführung einer Identifikationsnummer in die öffentliche Verwaltung" die Steuer-ID zu einer allgemeinen Bürgernummer für alle Ämter zu erweitern. Der Entwurf, welcher diese Woche von netzpolitik.org veröffentlicht wurde, basiert auf dem Vorhaben der großen Koalition einen virtuellen Zusammenschluss der Melderegister und behördlicher Datenbanken zu erreichen. Dieses soll entsprechend den Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes in Form einer verwaltungsübergreifenden Identifikationsnummer geschehen, die „auf den vorhandenen Strukturen der Steuer-ID“ aufbaut und diese „um die für ein registerübergreifendes Identitätsmanagement notwendige(n) Elemente“ erweitert. Das Vorhaben stößt unter Datenschützer*innen und Verfassungsrechtler*innen auf heftige Kritik.
Zum RefE des BMI.
Zur Meldung bei netzpolitik.org.
Zur Entschließung der DSK.
Zur Kritik des Bundesdatenschutzbeauftragten im Tagesspiegel.
Streit um App-Store Provisionen spitzt sich zu
Ein kalifornisches Gericht hat entschieden, dass der Fortnite-Bann aus dem Apple Store seitens Apple zwar beibehalten, aber weitere Schritte gegen die Unreal Engine des Herstellers Epic Games, nicht unternommen werden dürften. Apple hat daraufhin das Entwicklerkonto von Epic Games gesperrt, nicht aber die Unreal Engine. Der kalifornische Konzern begründet diesen Schritt damit, dass mehrfach Updates eingereicht wurden, die gegen die App-Store-Richtlinien verstoßen hätten. Auch Facebook schloss sich bereits Mitte August dem Protest gegen die 30% Provision an, die Apple bei In-App-Käufen verlangt. Vergangene Woche lehnte Apple nun auch ein Update der Facebook-App ab, weil in diesem auf die Abgaben an Apple hingewiesen wurde. Apple begründete seine Haltung damit, dass Nutzer*innen keine „irrelevanten“ Informationen angezeigt werden sollten.
Zur Meldung auf heise.de.
Zur Meldung auf Reuters.
VG Berlin: BMI muss Einsicht in Twitter Chats gewähren
Das Verwaltungsgericht Berlin hat vergangene Woche entschieden, dass von der behördlichen Herausgabepflicht in Bezug auf Akten auch private Nachrichten, bspw. auf Twitter, inbegriffen sind. Hintergrund war ein Rechtsstreit zwischen der Internetplattform „FragDenStaat“ und dem Bundesinnenministerium (BMI). FragDenStaat hatte gegen das BMI geklagt, da dieses die Offenlegung von Twitter Nachrichten des Ministeriums-Accounts verweigert hatte. Das VG Berlin hat nun klargestellt, dass nicht das Vorliegen einer Information in einer Akte, sondern das Vorliegen einer amtlichen Information an sich – egal, ob in einer Akte oder in sozialen Netzwerken – für die Herausgabepflicht ausschlaggebend ist. Damit werde einer „Flucht auf private Kanäle“ ein Riegel vorgeschoben. Ob dies auch für E-Mails gilt, die Minister in ihrer offiziellen Funktion von ihren privaten Mailadressen verschicken, ist fraglich, ein diesbezüglicher Rechtsstreit noch anhängig.
Zur Klageschrift.
Zur Pressemitteilung von FragDenStaat.
Zur Meldung auf heise.de.
TikTok reicht Klage gegen US-Regierung ein
Die Betreiber der chinesischen Videoplattform TikTok haben beim Bundesgericht in Los Angeles Klage gegen die US-Regierung eingereicht. Sie richtet sich gegen ein Anfang August durch Präsident Donald Trump unterzeichnetes Dekret, welches ein Verbot der Plattform ab Mitte September vorsieht. Die Social Media Plattform begründete die Klageerhebung mit dem „extremen" Vorgehen der US-Regierung; das Unternehmen stelle aus eigener Sicht keine Gefahr für die nationale Sicherheit dar.
Zur Pressemitteilung von TikTok.
Zur Meldung auf Zeit Online.
LfDI BW veröffentlicht Orientierungshilfe zu internationalen Datenverkehr
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg hat am Montag überraschend eine Orientierungshilfe zu internationalen Datentransfers veröffentlicht. Darin formuliert die Aufsichtsbehörde ihre Erwartungshaltung an Verantwortliche, die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten auf internationale Infrastrukturen und Dienstleister zurückgreifen. Neben einer anschaulichen Zusammenfassungen der Auswirkungen des "Schrems II" Urteils des EuGH (C-311/18) bietet die Orientierungshilfe auch konkrete Vorschläge zu einer etwaig notwendigen Anpassung der EU Standardvertragsklauseln. Diese finden, anders als das vom EuGH für unwirksam erklärte Privacy Shield, nach wie vor als Grundlage internationaler Datentransfers Anwendung.
Zur Orientierungshilfe des LfDI BW.
23.08.2020 18:44
+++ Streit um Anteil bei In-App-Käufen: Epic v. Apple und Google+++ Vorgehen der Datenschutzbehörden: Tracking auf Medienseiten
+++ BDSB Kelber kritisiert Patientendaten-Schutz-Gesetz
+++ NGO reicht Beschwerden wegen unerlaubten Datentransfers ein
+++ BMI v. BDSB vor dem VG Köln: Kontakdaten bei IFG-Anfragen
+++ „Quellen-TKÜ plus” für gespeicherte Nachrichten geplant Streit um Anteil bei In-App-Käufen: Epic v. Apple und Google
Epic Games, Entwickler des populären Spiels Fortnite, hat eine groß angelegte Kampagne gegen die Geschäftsbedingungen der beiden App-Plattformen von Apple und Google gestartet. Epic wendet sich gegen die hohen Anteile (30% im AppStore) der Plattformanbieter bei In-App-Käufen. Zuvor hatte der Gamesentwickler in dem Spiel eine Funktion eingeführt, die es Spieler*innen erlaubte, innerhalb der Spiele direkt bei Epic eigene Käufe zu entrichten. Dies verstößt jedoch gegen die Regeln der App-Plattformen, weshalb Fortnite aus den Stores entfernt wurde. Als Reaktion auf die Entfernung reichte Epic umgehend Klage wegen wettbewerbsschädigenden Verhaltens vor kalifornischen Gerichten gegen beide Unternehmen ein. Mit einer einstweiligen Verfügung will Epic nun die Kündigung des Vertrages für das Entwicklerprogramm durch Apple verhindern. Des Weiteren startete die Firma eine Kampagne unter #FreeFortnite, um auf die eigene Situation aufmerksam zu machen. Der Streit über das Spiel geht jedoch weit über den aktuellen Sachverhalt hinaus – seit Einführung der App-Stores Ende der 2000er Jahre streiten App-Entwickler und Konzerne über die Verteilung der Einnahmen bei In-App-Käufen.
Zur Meldung bei der Süddeutschen Zeitung.
Weiteres bei heise online.
Vorgehen der Datenschutzbehörden: Tracking auf Medienseiten
Die Landesdatenschutzbehörden wollen die Internetpräsenzen von Medienunternehmen auf ihre Tracking-Dienste untersuchen. Der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink hat dazu vergangene Woche ein gemeinsames „groß angelegtes Verfahren” angekündigt. Tracking-Technologien dienten u.a. dazu, Nutzer*innen geräteübergreifend wiederzuerkennen und ein Nutzer-Profil von ihnen anzulegen und zu speichern. Dies könne mit Dritten geteilt und so sensible Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden. Hierfür bedürfe es der Einwilligung der Betroffenen – oft durch Cookie Banner. Ob dabei die Anforderungen an eine freiwillige und informierte Einwilligung nach den Vorgaben der DSGVO erfüllt werden, wollen die Datenschützer jetzt kontrollieren.
Zur Pressemitteilung des LfDI Baden-Württemberg.
Zur Meldung bei Golem.de.
BDSB Kelber kritisiert Patientendaten-Schutz-Gesetz
Aus Sicht des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (BfDI), Ulrich Kelber, droht das Patientendaten-Schutz-Gesetz gegen die DSGVO zu verstoßen. Das hat der BfDI vergangene Woche in einer Pressemeldung dargelegt. Folge der Verabschiedung des Änderungsgesetzes in seiner aktuellen Fassung sei eine europarechtswidrige Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten. Dies betreffe insbesondere die Einführung der Elektronischen Patientenakte (ePA). Zwar möchte der Gesetzgeber europarechtskonformen Datenschutz dadurch gewährleisten, dass es den Patient*innen überlassen bleibt, ob sie die ePA überhaupt nutzen wollen, welche Daten gespeichert werden und welche Ärzt*innen auf die Akte zugreifen dürfen. Diese Maßnahmen seien aber nicht ausreichend, da die eigene Entscheidung über den Verbleib der Daten erst ab 2022 getroffen werden könnte. Bis dato könnten alle behandelnden Ärzt*innen sämtliche Patientendaten einsehen. Aufgrund dessen sieht Kelber nach Einführung der ePA aufsichtsrechtliche Maßnahmen für die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Krankenkassen vor. Bis zur DSGVO-konformen Ausgestaltung soll zudem ein Warntext des Bundesdatenschutzbeauftragten an alle Versicherten ergehen.
Zur Pressemitteilung des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.
Zur Meldung auf netzpolitik.org.
101 Beschwerden wegen unerlaubten Datentransfers
Die NGO noyb von und mit Max Schrems hat vergangene Woche Beschwerde bei den zuständigen Behörden gegen 101 europäische Unternehmen eingereicht, die weiterhin die Dienste Google Analytics oder Facebook Connect verwenden. Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) das sog. Privacy Shield zu stoppen, sei dies jedoch nicht mehr rechtmäßig. Durch die Verwendung der oben genannten Dienste gerieten die persönlichen Daten europäischer Nutzer*innen in die Hände großer US-Konzerne, wo sie vielseitig genutzt würden. Um die Datentransfers zu verhindern, müssten nach der EuGH-Entscheidung nun die europäischen Datenschutzbehörden eingreifen, kommentierte Schrems. Es sei nicht hinnehmbar, dass einige Akteur*innen das höchste europäische Gericht ignorierten.
Zur Meldung bei heise online.
Zur Meldung bei netzpolitik.org.
BMI v. BDSB vor dem VG Köln: Kontakdaten bei IFG-Anfragen
Das Bundesinnenminsterium hat vergangene Woche Klage gegen eine Weisung des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (BfDI) erhoben. Darin wehrt sich das Ministerium vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen eine Weisung des BfDI, keine weiteren personenbezogenen Daten von IFG-Antragstellern zu fordern als erforderlich. Über die vom Antragsteller hinaus übermittelten Kontaktdaten seien nach Ansicht des BfDI nur noch dann zusätzliche personenbezogene Daten zu verarbeiten, wenn ein Antrag ganz oder teilweise abzulehnen sein wird oder wenn Gebühren zu erheben sind. Im Kern geht es damit um den schon lange strittigen Punkt, wie weit sich Antragsteller offenbaren müssen (Name, postalische Anschrift) oder ob eine Antragstellung per E-Mail über Plattformen wie fragdenstaat.de auch weitgehend anonym möglich ist.
Zur Meldung bei heise online.
Zum Hintergrund bei fragdenstaat.de.
„Quellen-TKÜ plus” für gespeicherte Nachrichten geplant
Laut Plänen der Bundsministerien des Innern und der Justiz sollen Befugnisse der Sicherheitsbehörden zum Einsatz von Überwachungsmaßnahmen erweitert werden. Sicherheitsbehörden sollen demnach nicht nur die laufende Messenger-Kommunikation sowie Internet-Telefonate und Video-Calls abhören dürfen, sondern auch rückwirkend auf bereits gespeicherte Chats und Mails zugreifen. Damit soll gewissermaßen eine Maßnahme zwischen der Überwachung laufender Kommunikation mittels der sog. „Quellen-TKÜ” und einem Zugriff auf gespeicherte Daten, der sog. „Online-Durchsuchung” geschaffen werden. Umgesetzt werden sollen die Pläne im Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts.
Zur Meldung bei der Süddeutschen Zeitung.
Zur Meldung bei heise-online.
16.08.2020 19:52
+++ Facebook ändert Umgang mit parteinahen Nachrichtenseiten+++ Datenabfragen: Berliner Datenschutzbeauftragte kritisiert Polizei
+++ BMJV veröffentlicht Gesetzentwurf zu elektronischen Wertpapieren
+++ Songtexte auf Google: Genius verliert in den USA
Facebook ändert Umgang mit parteinahen Nachrichtenseiten
Facebook behandelt künftig Nachrichtenseiten strenger, die von einer politischen Partei betrieben werden oder ihr nahestehen. Solche Seiten werden nicht mehr auf nicht mehr auf Facebook News gelistet; Werbung muss speziell gekennzeichnet sein und die Seiten können nicht mehr auf bestimmte Schnittstellen zugreifen. Facebook will damit gegen die Manipulation von Wahlen vorgehen. Facebook hat außerdem die Gemeinschaftsrichtlinien geändert und untersagt neuerdings u.a. das sog. „Blackfacing” und die Werbung mit „dubiosen“ Diätprodukten, wie es bei heise.de heißt.
Meldung bei heise.de.
Datenabfragen: Berliner Datenschutzbeauftragte kritisiert Polizei
Die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk beanstandet das Verhalten der Berliner Polizei bei der Aufklärung „fragwürdiger Abfragen“ in Polizeidatenbanken. In einer Pressemitteilung (PDF) kritisiert sie, dass die Polizei für nicht nachvollziehbare Datenabrufe bei Opfern von rechtsextremen Bedrohungen offenbar keine Begründung geliefert hat. Die Polizei rechtfertige dies mit Auskunftsverweigerungsrechten; die stünden der Polizei nach Ansicht der Datenschutzbeauftragten so pauschal aber gar nicht zu. Die lückenlose Aufklärung solcher Bedrohungen liege auch im Interesse von Polizeibehörden, die „derzeit aufgrund der sich häufenden Fälle von unrechtmäßigen Datenabfragen und Kontakten zum rechtsextremen Spektrum im Fokus der Öffentlichkeit stehen“, so Smoltczyk.
Zur Pressemitteilung der Berliner Datenschutzbeauftragten.
BMJV veröffentlicht Gesetzentwurf zu elektronischen Wertpapieren
Das Bundesjustizministerium hat einen Gesetzentwurf zur Einführung von elektronischen Wertpapieren veröffentlicht. Nach aktueller Rechtslage können Wertpapiere nur in einer Papierurkunde verbrieft sein. Künftig soll es auch elektronische Wertpapiere und Krypto-Wertpapiere geben. Damit die Verkehrsfähigkeit und der rechtssichere Erwerb gewährleistet sind, werden Eintragungen in zentrale und dezentrale Register auf Basis der Blockchain-Technologie möglich sein, so das BMJV.
Zur Pressemitteilung des BMJV und zum Referentenentwurf.
Die FAZ mit Reaktionen auf den Entwurf.
Songtexte auf Google: Genius verliert in den USA
Die Songtexte-Datenbank Genius.com kann Google nicht verbieten, Songtexte aus der Genius-Datenbank direkt auf der Google-Seite in einer Box anzuzeigen. Das hat das US-Bundesbezirksgericht in New York entschieden. Genius hätte allein aus dem Copyright an den Songlyrics vorgehen können – ist aber selbst kein Rechteinhaber. Das US-Copyright versperrt in diesem Fall die Möglichkeit, sich auf das Wettbewerbsrecht oder ungerechtfertigte Bereicherung einzelner US-Staaten zu berufen. Hintergrund ist eine Regelung im US-Copyright, die verhindern soll, dass Bundesstaaten unterschiedliche Schutzstandards im bundesweit einheitlichen US-Copyright schaffen. Im Gegensatz zur EU gibt es in den USA keinen Datenbankschutz, auf den Genius sich berufen könnte.
Mehr bei heise.de.
09.08.2020 17:02
+++ Referentenentwurf zum „TTDSG” geleakt+++ TKG-Novelle verzögert sich
+++ Frankreich: 250.000 Euro DSGVO-Bußgeld gegen Spartoo
+++ LG Trier: Prozess gegen Betreiber des „Cyberbunker” startet im Oktober
+++ Staatsanwaltschaft Berlin stellt Ermittlungen gegen „Datendieb” ein
+++ TikTok: Doch kein Datenzugriff durch chinesische Behörden?
Referentenentwurf zum „TTDSG” geleakt
Vergangene Woche wurde ein Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) für ein neues „Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz”, kurz TTDSG geleakt. Das neue "TTDSG" soll die Regelungen zum Datenschutz für Internetangebote (Telemedien) sowie für Telekommunikationsdienste und -netze in einem Gesetz zusammenführen. Die bisherigen Regelungen zum Datenschutz sowie zum Fernmeldegeheimnis im Telemediengesetz (TMG) und im Telekommunikationsgesetz (TKG) werden gestrichen. Außerdem soll das Gesetz einen neuen Rechtsrahmen für Identitätsmanagement-Plattformen
Erste Einschätzung von Gerd Kiparski im CR-Blog.
Der Referententwurf im Volltext.
TKG-Novelle verzögert sich
Die Reform des Telekommunikationsgesetzes (TKG) lässt auf sich warten. Die Novelle sollte eigentlich am Freitag in die Anhörung der Länder und Verbände gehen. Mehrere Bundesministerien blockieren jedoch die Herausgabe des Entwurfs. Gründe dafür sind Unstimmigkeiten zwischen den Ministerien, u.a. führt das Bundesinnenministerium Sicherheitsbedenken an. Mit dem Gesetz soll die EU-Richtlinie zum „Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation” in nationales Recht umgesetzt werden, es enthält jedoch auch noch weitere Reformen, z.B. mit Blick auf neue Sicherheitsvorschriften für Telekommunikationsnetze („lex Huawei”).
Weitere Informationen auf Heise Online.
Frankreich: 250.000 Euro DSGVO-Bußgeld gegen Spartoo
Die französische Datenschutzbehörde CNIL hat gegen den Online-Schuhversand Spartoo ein DSGVO-Bußgeld in Höhe von 250.000 Euro verhängt. Spartoo soll Bankdaten unverschlüsselt gespeichert und Gespräche der Telefon-Hotline aufgezeichnet haben. Zudem soll Spartoo Speicher- und Löschfristen für die Daten von rund 25 Millionen Kunden nicht eingehalten haben. Bei den europaweit relevanten Datenschutzverstößen hat die CNIL mit mehreren nationalen Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet.
Zur Pressemitteilung der CNIL (Französisch).
Zusammenfassung des Falls auf Heise Online.
LG Trier: Prozess gegen Betreiber des „Cyberbunker” startet im Oktober
Das Landgericht Trier hat vergangene Woche die Anklage gegen acht mutmaßliche Betreiber des sogenannten „Cyberbunkers“ zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Den Angeklagten wird vorgeworfen, im rheinland-pfälzischen Traben-Trarbach ein groß angelegtes illegales Rechenzentrum betrieben zu haben. Über die dortigen unterirdischen Server wurde es Kriminellen auf der ganzen Welt ermöglicht, illegale Geschäfte über die gehosteten Webseiten abzuwickeln. Hauptakteur soll ein Niederländer sein, der beschuldigt wird, den „Cyberbunker” 2013 erworben und weiter aufgebaut zu haben. Die zweimal wöchentlich angesetzte Hauptverhandlung soll ab Oktober bis Ende 2021 geführt werden.
Weitere Informationen auf LTO.
Staatsanwaltschaft Berlin stellt Ermittlungen gegen „Datendieb” ein
Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihre Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Datenhändler eingestellt, dem zuvor vorgeworfen wurde, bei der Bundesagentur für Arbeit eine Vielzahl unechter Stellenangebote inseriert zu haben. Darüber wollte er Daten der Bewerber abgreifen und verkaufen. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft liegt aber kein hinreichender Tatverdacht gegen den Beschuldigten vor, denn es seien keine Personen bekannt geworden, die dem Beschuldigten gegenüber tatsächlich ihre Daten offenbart hätten. Datenschützer kritisieren die Entscheidung der StA Berlin scharf.
Weitere Informationen auf sueddeutsche.de.
TikTok: Doch kein Datenzugriff durch chinesische Behörden?
Die US-Regierung hat angekündigt, TikTok verbieten zu wollen, angeblich wegen Angst vor dem Zugriff chinesischer Geheimdienste auf Daten von US-Bürgern. TikTok allerdings fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Eine derartige Möglichkeit bestehe für chinesische Behörden nicht, so ein Sprecher des Unternehmens. Man habe weder eine Niederlassung in der Volksrepublik China, noch finde chinesisches Recht auf das Unternehmen Anwendung. Die Nutzerdaten lägen derzeit in Datenzentren von Drittanbietern in den USA und Singapur.
Weitere Informationen bei Heise Online.
Update, 9.8.2020. 23:30: Der Datenschutzbeauftragte von verimi, Christian Aretz, hat über Twitter klargestellt, dass verimi derzeit nicht plant, als zertifizierter Anbieter eines „Anerkannte Dienstes zur Verwaltung persönlicher Informationen” nach § 3 TTDSG auzutreten. Wir haben dies deshalb oben korrigiert.
02.08.2020 17:37
+++ USA: Amazon verzeichnet Anstieg von Behördenanfragen+++ Halbjahresbilanz beim NetzDG
+++ LG Köln: Influencer und Werbekennzeichnung
+++ Corona-Gästelisten und Strafverfolgung
USA: Amazon verzeichnet Anstieg von Behördenanfragen
Amazon hat im ersten Halbjahr 2020 einen Anstieg von Behördenanfragen um rund ein Viertel gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Im Fokus stehen dabei Daten von Nutzern des Online-Shops, Sprachassistenten und Tablets. Das Unternehmen betont staatliche Forderungen, die sie für überzogen hielten, wiederholt angefochten zu haben und dadurch zur Verbesserung der rechtlichen Standards zum Schutz von Meinungsfreiheit und Privatsphäre beigetragen zu haben.
Zur Meldung auf heise.de.
Halbjahresbilanz beim NetzDG
Die großen Betreiber Sozialer Netzwerke haben ihre Halbjahresbilanz in Sachen Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) vorgelegt. TikTok nennt 141.800 Beschwerden über Straftaten, von denen ein Großteil auf Beleidigungsdelikte oder Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Bildaufnahmen zurückzuführen seien. In zehn Prozent der Fälle ergriff der Betreiber nach der Prüfung weitere Maßnahmen. YouTube, Facebook und Google verzeichnen dagegen deutlich mehr Fälle. Twitter kommt gar auf 765.715 Beschwerden, die meisten davon wegen Volksverhetzung.
Zur Meldung auf heise.de.
LG Köln: Influencer und Werbekennzeichnung
Wie das LG Köln in einem am Freitag veröffentlichten Urteil entschieden hat, muss eine Influencerin ihre Beiträge auf Instagram auch dann als Werbung kennzeichnen, wenn sie für diese nicht vergütet wird (Az. 33 O 138/19). Auch ohne Werbevertrag handle es sich bei den Produktempfehlungen um geschäftliche Handlungen, die der Absatzförderung dienten. Die Mode- und Lifestyle-Influencerin hatte von ihr getragene Produkte und Accessoires getagged und damit auf Profile der Hersteller verlinkt. Nach Aufassung des Gerichts fördere sie damit die Hersteller als auch ihr eigenes Unternehmen als Influencerin.
Zur Meldung auf LTO.
Corona-Gästelisten und Strafverfolgung
Zeitungsberichten zufolge verwenden Strafverfolgungsbehörden in einigen Bundesländern die Corona-Gästelisten aus Restaurants zur Aufklärung und Verfolgung von Straftaten. Während der Innenminister von Baden-Württemberg ein solches Vorgehen als unzulässig zurückweist, verweist das Bundesjustizministerium auf die allgemeinen strafprozessualen Voraussetzungen. Der Gaststättenverband Dehoga spricht von einer hochgradig sensiblen Angelegenheit und fordert eine verbindliche Klarstellung.
Zur Meldung auf LTO.
Zur Meldung auf heise.de.
02.08.2020 13:54
+++ 3.-7. August: Veränderung der Politik durch Digitalisierung, Kochel am See+++ 10.-15. August: Summer School IT Law, Saarbrücken + online
+++ 11. August: Europas digitale Wettbewerbspolitik verschärfen?, online
+++ 13.-14. August: 7. Deutscher IT-Rechtstag 2020, Berlin + online
+++ 24.-26. August: Inclusive AI? The challenges of automated tools in HR, Berlin
+++ 24.-28. August: European Consortium for Political Research Conference, online
+++ 26. August: Digitaler Salon: The troll next door, Berlin + online
Wie verändert die Digitalisierung die Welt der Politik?
Die Georg von Vollmar Akademie e.V. veranstaltet das Seminar „Wie verändert die Digitalisierung die Welt der Politik?“. Es befasst sich mit dem Thema, wie sich die Digitalisierung auf die Demokratie auswirkt. Beeinflussen soziale Medien unsere Kommunikation oder sogar unser Wahlverhalten? Wie wirken sich „Big Data“ und „Industrie 4.0“ auf unsere Demokratie aus? Diesen und weiteren Fragen widmet sich das Seminar.
Termin: 3.-7. August 2020
Wo: Georg von Vollmar Akademie e.V., Kochel am See
Anmerkungen: Dieses Seminar kann auf Antrag als Bildungsurlaub anerkannt werden.
Anmeldung und nähere Informationen.
Summer School IT Law and Legal Informatics
Zum vierten Mal in Folge findet die internationale Summer School an der Universität Saarbrücken statt. Sie richtet sich vor allem an Student*innen und Forscher*innen. Sie können dabei aktuelle Themen des IT-Rechts in einem internationalen Forum diskutieren. Eine Teilnahme ist dieses Jahr online und in Präsenz vor Ort möglich. Die Themenschwerpunkte sind Datenschutz und IT-Sicherheit sowie KI und Recht.
Termin: 10.-15. August 2020
Wo: Universität des Saarlands, Saarbrücken + online
Anmerkungen: kostenpflichtig, Anmeldung erforderlich!
Anmeldung und nähere Informationen.
Hintergrundgespräch: Wie Europas digitale Wettbewerbspolitik verschärfen?
Aline Blankertz von der Stiftung Neue Verantwortung spricht mit Amelia Fletcher, der ehemaligen Chefökonomin der britischen Wettbewerbsbehörde. Fletcher war außerdem Teil der britischen Expert*innen-Kommission zur Stärkung des digitalen Wettbewerbs. In Großbritannien ist das Instrument der Marktuntersuchung etabliert, um wirksamer in plattformdominierte digitale Märkten einzugreifen. Taugen die wettbewerbspolitischen Werkzeuge auch als Vorbild für die Europäische Kommission? Diese Frage werden Blankertz und Fletcher bei dem Hintergrundgespräch diskutieren.
Termin: 11. August 2020, 16 bis 17 Uhr
Wo: online
Anmerkungen: Anmeldung erforderlich!
Anmeldung und nähere Informationen.
7. Deutscher IT-Rechtstag 2020
Die davit fördert seit nunmehr 20 Jahren die Vernetzung der Kolleg*innen, die sich mit Fragen des IT-Rechts, des Multimediarechtes und mit Rechtsfragen im Bereich der digitalen Güter, Daten, Services und Medien befassen. Wer nicht präsent sein kann, bekommt die Möglichkeit, sich online dazu zu schalten.
Termin: 13.-14. August 2020
Wo: Mercure Hotel MOA, Berlin + online
Anmerkungen: kostenpflichtig, Anmeldung erforderlich!
Anmeldung und nähere Informationen.
1st Pop-Up Lab: Inclusive AI? The challenges of automated tools in HR
Mitarbeiter*innen im Personalmanagement verwenden mehr und mehr KI-gesteuerte Instrumente. Damit treffen sie z.B. eine Vorauswahl der Bewerber*innen. Solche Instrumente sollen kostengünstig sein und sogar die Diskriminierung bei Bewerbungsprozessen beenden. Doch Kritiker*innen warnen davor, dass diese Tools genauso voreingenommen sein können, wie ihre Entwickler*innen. Ziel dieses interdisziplinären Workshops ist es, dass promovierte Forscher*innen und Masterstudent*innen Einblicke in diese Thematik bekommen. Außerdem können sie sich mit NGOs austauschen, die sich mit KI-bezogenen Themen im Personalmanagement befassen.
Termin: 24.-26. August 2020
Wo: Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, Berlin
Anmerkungen: Bewerbung erforderlich bis 05. August!
Anmeldung und nähere Informationen.
European Consortium for Political Research Conference
Das ECPR lädt zur diesjährigen Konferenz ein. Die Veranstaltung hätte planmäßig in Innsbruck stattfinden sollen. Nun findet sie virtuell statt. Das Hans-Bredow-Institut in Hamburg beteiligt sich unter anderem mit zwei Vorträgen am Panel „Governing the Platform Society“. Dr. Thorsten Thiel vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung beteiligt sich am genannten Panel mit einem Vortrag zum Thema „Governance of Big Transformations“.
Termin: 24.-28. August 2020
Wo: online
Anmerkungen: kostenpflichtig, Anmeldung erforderlich!
Anmeldung und nähere Informationen.
Digitaler Salon: The troll next door
Warum gehen die Umgangsformen und Interaktionen auf digitalen Plattformen so auseinander? Liegt es an den Menschen, die sie nutzen oder an den Algorithmen? Wie unterscheidet sich eine Diskussion in den sozialen Medien von einem persönlichen Gespräch? In digitalen Debatten sind Shitstorms und Hate Speech keine Seltenheit. Wer geht dagegen vor? Gibt es eine digitale Zivilcourage? Die Moderatorin Kaja Weber diskutiert über diese Themen mit verschiedenen Gästen. Auch diese Veranstaltung findet präsent und als Livestream auf hiig.de statt.
Termin: 26. August 2020, 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr)
Wo: Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, Berlin + online
Anmerkungen: Anmeldung erforderlich!
Anmeldung und nähere Informationen.
240515_akit

22. @kit-Kongress, 12. Forum "Kommunikation & Recht"
15.-17. Mai 2024 | Köln
Ab 50,- Euro teilnehmen!
Sichern Sie sich Ihr Ticket, vor Ort oder Online, zum 22. @kit-Kongress.
Alle Informationen unter
www.ruw.de/akit