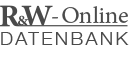Den Bürgern wurde eine „gute“ Grundsteuer versprochen
Die neue Grundsteuer kommt, so viel steht fest. Nicht fest steht hingegen, wie teuer und aufwendig das für den einzelnen Bürger wird. Dabei dürfte die Frage, ob Wohnen teurer wird, entscheidend für die Akzeptanz der Reform sein.

Wohnen muss bezahlbar bleiben! Ein Satz, den Politiker gern an Vermieter und Bauindustrie richten. Dabei lassen sie oft außer Betracht, dass auch der Staat über Steuern und Abgaben an den Wohnkosten beteiligt ist. Unbestritten ist, dass die Gemeinden zahlreiche Aufgaben schultern müssen. Daher sind die Grundsteuereinnahmen von knapp 15 Milliarden Euro für die Kommunen durchaus bedeutend, zumal sie jährlich wiederkehrend und damit zeitlich unbegrenzt anfallen. Wenig erstaunlich ist daher, dass sich auch die Bürger für die Grundsteuerreform interessieren – schließlich ist es ihr Portemonnaie, aus dem die Steuer gezahlt wird. Deshalb ist ihr Interesse berechtigt, durch die Grundsteuerreform nicht strukturell stärker belastet zu werden.
Versprochen wurde ihnen, dass die Reform aufkommensneutral bleibt. Das heißt, die Gemeinden sollen nicht allein durch die gesetzliche Änderung höhere Einnahmen erhalten. Zweifel daran, ob dieses Versprechen auch eingehalten wird, sind nachvollziehbar – insbesondere bei Bewertungsmodellen, die sich am Wert des Grundstücks orientieren. Denn steigt der Wert des Grundstücks, erhöht sich automatisch auch die Grundsteuer. Deshalb nutzen einige Bundesländer richtigerweise die Möglichkeit, eigene Ländermodelle zu beschließen und zum Beispiel die Fläche des Grundstücks zum Maßstab für die Grundstücksbewertung zu nehmen. Dies verringert die Gefahr stetig steigender Steuern und erhöht zugleich die Transparenz: Je einfacher ein Modell, desto eher ist der Steuerzahler in der Lage, dieses nachzuvollziehen und auch nachzurechnen.
Letztlich hängt die Höhe der Grundsteuerbelastung vom Verhalten der Gemeinden ab. Sie entscheiden weiterhin vor Ort über die Hebesätze und legen damit die Steuerbelastung ihrer Bürger fest. Haltelinien gibt es im Gesetz zwar nicht, doch Möglichkeiten, Steuereinnahmen zu begrenzen, sehr wohl. Erste Ideen liegen bereits vor. So sollte den Bürgern transparent mitgeteilt werden, bei welchem Hebesatz die Steuereinnahmen stabil bleiben. Entschließt sich die Gemeinde für einen höheren Satz, ist dies zumindest erklärungsbedürftig. Wichtig ist es, bei der Grundsteuer Transparenz zu schaffen, um ein faires Miteinander zwischen Steuerzahlern und kommunaler Politik zu ermöglichen.
Neben der finanziellen Belastung stellt sich auch die Herausforderung, dass rund 36 Millionen Immobilieneinheiten neu bewertet werden müssen. Das Gesetz selbst geht von immensen Bürokratiekosten aus. Hinzu kommt die Parallelstruktur zwischen dem altem und dem neuen Recht bis Ende 2024. Dies ist ein Aufwand, der sich nicht nur bei der Verwaltung spiegelt, sondern auch auf die Bürger kommen Pflichten zu. Je nachdem, für welches Bewertungsmodell sich das Bundesland entschieden hat, werden die Anforderungen unterschiedlich sein, was sich an Umfang und Detailtiefe der Grundsteuererklärung zeigen wird, die die Grundstückseigentümer abgeben müssen. Denn fest steht, dass die Grundsteuerdatenbank LANGUSTE bis zum neuen Bewertungsstichtag am 1. Januar 2022 nicht zur Verfügung stehen wird.
Das Zusammenspiel zwischen Steuerbelastung, Aufwand und Transparenz dürfte entscheidend sein, um bei den Bürgern für die Akzeptanz der Steuer zu sorgen. Je höher die Belastung, je größer der Aufwand und je geringer die Transparenz, desto weniger schmeckt dem Bürger die Reform – selbst dann nicht, wenn die neue Grundstücksdatenbank LANGUSTE heißt.
 | Autorin Dr. Isabel Klocke Leiterin des Bereichs Steuerrecht und Steuerpolitik beim Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. |