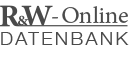Europäische ESG-Regulierung
„Indirekte Verhaltenssteuerung auf Kosten der Anleger?“
Um ubiquitäre Nachhaltigkeitsziele im Sinne der ESG-Doktrin umzusetzen, verfolgen der europäische und die nationalen Gesetzgeber vorwiegend eine Strategie indirekter Verhaltenssteuerung. Die realwirtschaftlichen Unternehmen sollen durch eine ESG-orientierte Kanalisierung der Finanzströme zu mehr „Nachhaltigkeit“ im ökologischen und sozialen Sinne angehalten werden. Zu diesem Zweck erfahren die Wirtschaftskreisläufe eine Art Rundumregulierung, die im Kern darauf abzielt, das Kapital von seinen Ursprüngen bei den Privathaushalten über die Zwischenstufe der Finanzintermediäre, insbesondere der Investmentfonds, denjenigen emittierenden Unternehmen zuzuleiten, die am „nachhaltigsten“ wirtschaften. Nach dem Europäischen „Aktionsplan Sustainable Finance“ und nach den hieraus bis jetzt hervorgegangenen Regelwerken sind praktisch alle an der kapitalmarktlichen Unternehmensfinanzierung beteiligten Entscheidungsträger Adressaten eines ausgeklügelten und ungemein aufwendigen „Nudging“-Anreizsystems. Ob sich dieses Konzept bewähren kann, ist derzeit Gegenstand reger Auseinandersetzung in den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Schwierigkeiten bereiten allein schon diverse technisch-handwerkliche Mängel in erstaunlicher Vielzahl, die vor systemtragenden Kernelementen nicht haltmachen. Dazu gehören etwa das Hantieren mit unscharfen und substanzarmen Zentralbegriffen, anhand derer zu prüfen sein soll, ob das Qualitätssiegel „ESG“ auf ein Unternehmen zutrifft oder nicht („Wirtschaftstätigkeit“, Art. 8 Taxonomie-VO), oder die kaum durchdachte, jedenfalls aber sachwidrige Verortung genuin aufsichtsrechtlicher Regelungen des Investmentrechts im Aktienrecht mit der Folge, dass gerade die einflussreichsten institutionellen Investoren mit Sitz außerhalb der Europäischen Union vom Gesamtreglement nicht erfasst sind.
Unabhängig davon geben die bisherigen Erfahrungen in der Kapitalmarktpraxis Anlass für Zweifel am Kern des Konzepts. Während die Europäische Kommission ausweislich ihres Aktionsplans davon ausgeht, dass nachhaltige Kapitalanlagen zugleich mit Renditevorteilen einhergehen, spricht die Empirie eine andere Sprache. Zwar hat sich die ökonomische Forschung hierzu noch nicht abschließend positioniert. Allerdings lässt sich jedenfalls anekdotisch beobachten, dass ESG-affine Titel im Vergleich mit „braunen“ Kapitalanlagen keinesfalls stets mit Überrenditen einhergehen: Im bisherigen Jahresverlauf erfreuen sich gerade Rüstungsaktien als prototypische „braune“ Kapitalanlagen – u. a. aufgrund des Ukraine-Krieges – einer denkbar positiven Entwicklung (FAZ v. 31. 5. 2022, S. 23). Warum sich dies auf lange Frist grundsätzlich ändern sollte, ist leider nicht ersichtlich. Währenddessen lässt sich umgekehrt beobachten, dass institutionelle Investoren eine vorrangig „grüne“ bzw. ESG-konforme Kapitalbewirtschaftung in ihren Portfoliogesellschaften jedenfalls dann nicht goutieren, wenn sie hierdurch ihre Renditeinteressen gefährdet sehen. Auch Verbraucherschützer weisen zunehmend auf die finanziellen Risiken hin, die sich mit der Bewerbung „grüner“ Kapitalanlagen gerade für Kleinanleger verbinden können.
Die Kommission erkennt diese Widersprüche offenbar selbst – insbesondere, wenn sie in Fortentwicklung des MiFID II-Regimes auch Privatanleger weicher, indirekter Verhaltenssteuerung per „Nachhaltigkeits-Nudge“ aussetzt: So sind Anlageberater künftig verpflichtet, im Beratungsgespräch explizit nach den „Nachhaltigkeitspräferenzen“ der Anleger zu fragen. Selbst wenn man unterstellt, dass diese Evaluierung trotz reichlich diffuser Vorstellungen über den Nachhaltigkeitsbegriff gelingt, bleibt jedenfalls festzuhalten, dass es eines solchen „Nudgings“ nicht bedürfte, wenn ESG-affine Anlagen ohnehin – wie verbreitet behauptet – mit Überrenditen einhergingen. Die Kommission will hier verräterischerweise ein wenig „nachhelfen“ und verkennt dabei u. a., dass nachhaltigkeitsaffine Haltungen erfahrungsgemäß oft vorschnell und aus Schamgefühl (für eigentlich finanzielle Präferenzen) zur Schau gestellt werden (sog. Social Desirability Bias). Zwar ist unbestritten, dass Klimaschutz und soziale Wohlfahrt zu den wichtigsten Aufgaben der Gesetzgebung gehören. Die „Sustainable-finance“-Regulierer wären aber ehrlicher, wenn sie den latenten Konflikt zwischen Gemeinwohl- und Renditeinteressen deutlich benennen würden. Anderenfalls sind die „Versuchskaninchen“ von heute womöglich die Opfer von morgen. Die sozialen Nachteile tragen nicht zuletzt jene Anleger davon, die auf den politischen Rat der vergangenen Jahre gehört und ihre Ersparnisse zwecks Altersvorsorge in Kapitalanlagen investiert haben.

Dr. Björn Schneider ist Assistent am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung der JLU Gießen. Er arbeitet u. a. an verschiedenen Forschungsprojekten zur zivilrechtlichen Nachhaltigkeitsregulierung.