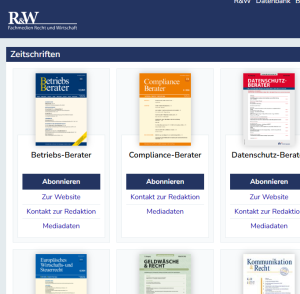Whistleblowing Report 2025: Hinweisgeberschutz – mehr als eine regulatorische Notwendigkeit
Schadensbegrenzung und ein Gewinn für die Kultur der Offenheit, das seien die Vorteile aus der Einrichtung von Meldestellen und Beschwerdestellen, schlussfolgern die EQS Group und die Fachhochschule Graubünden aus ihrem Whistleblowing Report 2025.

Meldung per Telefon: Noch dominieren traditionelle Kanäle bei der Kontaktaufnahme zur Meldestelle.
Insgesamt 2.200 Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, der Schweiz, Spanien und den USA wurden für den neuen Whistleblowing Report 2025 befragt. Es ist der vierte Report dieser Art, den die EQS Group (EQS) gemeinsam mit der Fachhochschule Graubünden (FH) veröffentlicht. In der diesjährigen Ausgabe differenziert die Studie erstmals klar zwischen Meldestellen für interne Anspruchsgruppen (Mitarbeitende), die Missstände im Unternehmen aufdecken möchten, und Beschwerdestellen für externe Anspruchsgruppen (wie Kunden oder Lieferanten), die sich auf illegales oder unethisches Verhalten entlang der Lieferkette beziehen. In Deutschland haben 58 Prozent der befragten Unternehmen eine interne Meldestelle und 65 Prozent eine externe Beschwerdestelle eingerichtet, berichten EQS und FH.
Bei der Ausgestaltung der Meldestellen setzen deutsche Unternehmen laut dem Report auf eine Kombination verschiedener Kanäle zur Kontaktaufnahme für ihre Mitarbeitenden. Im Durchschnitt böten sie vier verschiedene Kontaktmöglichkeiten an. Dabei seien traditionelle Kanäle wie E-Mail (76 Prozent), persönliche Besuche (65 Prozent) oder Telefon (64 Prozent) weiterhin dominierend. Die Bedeutung webbasierter Hinweisgebersysteme und Internetplattformen steige jedoch.
Beschwerdestellen böten im Schnitt drei Kanäle an, wobei hier klassische Kontaktwege noch stärker im Vordergrund stünden.
EQS und FH sehen einen deutlichen Nutzen für Unternehmen in der Einrichtung von Melde- und Beschwerdestellen. So verzeichne jedes siebte deutsche Unternehmen (14 Prozent) Schäden von über 100.000 Euro durch illegales oder unethisches Verhalten. Mithilfe der Melde- oder Beschwerdestellen hätten jedoch gut die Hälfte der deutschen Unternehmen (51 Prozent) mehr als zwei Drittel des finanziellen Gesamtschadens aufdecken können. Hinweisgebersysteme seien also längst nicht mehr nur eine regulatorische Notwendigkeit, sondern strategische Instrumente, um Risiken frühzeitig zu identifizieren und wirtschaftliche Schäden zu begrenzen. Richtig eingesetzt könnten sie eine Kultur der Offenheit fördern, so EQS. Eine Schlussfolgerung, die in der nicht repräsentativen Studie zu den Auswirkungen des HinSchG auf die mittelständische Wirtschaft (siehe Seite 6 in dieser Ausgabe) offensichtlich nicht geteilt wird. Laut dem Whistleblowing Report 2025 stufen deutsche Unternehmen 57 Prozent der eingegangenen Meldungen und Beschwerden als relevant und inhaltlich gehaltvoll ein. Hinweise von eigenen Mitarbeitenden hätten sich besonders häufig auf die Themen Diversität und Respekt am Arbeitsplatz, Menschenrechte, Arbeitssicherheit und Gesundheits- sowie Datenschutz bezogen. Bei Hinweisen von externen Personen sollen Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Finanzberichterstattung sowie geschäftliche Integrität und Menschenrechte im Vordergrund gestanden haben.
Obwohl das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) Unternehmen nicht dazu verpflichtet, anonymes Melden anzubieten, hätten 70 Prozent der Meldestellen deutscher Unternehmen Anonymität gewährleistet. Bei den Beschwerdestellen seien es 55 Prozent. Laut EQS und FH sind dies im internationalen Vergleich Spitzenwerte.
Der Anteil missbräuchlicher Meldungen und Beschwerden, die das Unternehmen oder eine Person gezielt in Verruf bringen sollen, habe bei deutschen Unternehmen nur bei 12 Prozent gelegen – unabhängig davon, ob Anonymität möglich war oder nicht. Damit bestätige die Studie, dass anonymes Melden – entgegen dem häufig geäußerten Vorbehalt – nicht zu mehr missbräuchlichen Hinweisen führe.
chk