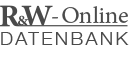EU-Plattformregulierung . . .

. . . und der Wettbewerb der Regelsetzer
Allein auf der supranationalen Ebene adressieren der Digital Markets Act (DMA) und der Digital Services Act (DSA) Online-Plattformen direkt, ebenso wie die sog. P2B-VO. Plattformen haben aber auch – je nach Ausgestaltung – Rechtsakte wie beispielsweise den Data Governance Act (DGA), die Free-Flow-of-Data-VO, die Umsetzungsnormen der E-Privacy-RL sowie der DSM-RL zu berücksichtigen. Sehr wahrscheinlich treten künftig der Data Act, der AI Act und der European Media Freedom Act hinzu.
Ob diese Vielzahl an Richtlinien, vor allem aber “Acts” (Verordnungen) nun eher “Act”-ionismus (vgl. Schmitz ZD 2022, 189) oder einem irgend gearteten Wettbewerbsdruck bei der EU-Kommission geschuldet sind, erscheint als lohnende (Forschungs-)Frage. I.R.d. 6. Symposiums der hochkarätigen Wissenschaftlichen Vereinigung für das gesamte Regulierungsrecht im Oktober 2022, das die Regulierung digitaler Plattformen zum Gegenstand hatte, wurde u. a. danach gefragt, ob die Plattformregulierung einem Systemwettbewerb unterliegt. Dieser auch unter den Bezeichnungen “institutioneller Wettbewerb” oder “Wettbewerb der Rechtsordnungen” v.a. aus dem (Internationalen) Gesellschaftsrecht bekannten Diskussion liegt die Annahme zugrunde, dass Vorschriften genauso wie Produkte dem wirtschaftlichen Mechanismus von Angebot (Normgeber) und Nachfrage (Rechtsunterworfene) unterliegen (nur Wernicke NJW 2017, 3038). Rechtsanwender begäben sich dementsprechend auf die Suche nach dem attraktivsten Regelungsrahmen, was zu einem race to the bottom in Form einer schädlichen Deregulierungsspirale oder einem race to the top, also zu einem hohen Regulierungsniveau, führen kann. Im letzteren Fall erschiene ein solcher Marktmechanismus für Recht als “Ware” sinnvoll (einen Verstoß gegen das Demokratieprinzip sieht indes Stark, Law for Sale: A Philosophical Critique of Regulatory Competition, 2019).
Nun kommt für die Plattformregulierung ein Wettbewerb der Regelsetzer zunächst horizontal zwischen den einzelnen mitgliedstaatlichen Rechtsregimen und zudem außereuropäischer nationaler Gesetzgebung in Betracht.
Hinzu tritt womöglich ein vertikaler Regelungswettbewerb, der europäische Vorgaben und innerstaatliche sowie föderale Regulierung betrifft. Hier könnten – wie Lea Katharina Kumkar (Universität Trier) auf besagter Konferenz überzeugend dargelegt hat – einerseits nationale Vorschriften als Vorbild für supranationale Gesetzgebung dienen. Dies mag etwa das NetzDG und den DSA sowie § 19a GWB und den DMA betreffen. Andererseits ergeben sich in der Folge gerade auch für ebendiese Bereiche handfeste Konkurrenzprobleme. Oft verwendet der EU-Normgeber hierbei (sowie im Verhältnis von EU-Regelwerken zueinander) nichtssagende Formulierungen wie “gilt unbeschadet von” oder “bleibt unberührt”. Hier wäre eine supranationale Konkurrenzlehre wünschenswert. Ob die Sekundärrechtsakte die nationalen Regelungen ablösen oder fortan neben ihnen bestehen, lässt sich nicht durch einen lapidaren Verweis auf den Anwendungsvorrang des Unionsrechts beantworten, denn es geht gerade um die Frage der sachlichen Reichweite des jeweiligen supranationalen Regelungsregimes, die nicht selten überdies mit den (Begrenzungen der) Brüsseler Gesetzgebungskompetenzen verbunden ist. Aus praktischer Sicht ist in diesem Zusammenhang wichtig – und darauf hat Robert Kilian (“Beams”) auf der Tagung zu Recht hingewiesen –, dass es nicht zur Doppelregulierung kommt und ein Mindestmaß an Regelungstransparenz aufrechterhalten bleibt. Insofern stellt sich außerdem die Frage, inwiefern die EU-Plattformregulierung den Betrieb von Plattformen aus Drittstaaten mit absichert. Der Anwendungsbereich der neueren EU-Digitalrechtsakte impliziert zumeist ein eher breites Marktortprinzip mit teilweise recht losem Binnenmarktbezug, für den mitunter bereits ausreicht, wenn eine Verhaltensbeobachtung von Personen auf dem Binnenmarkt erfolgt – und zwar losgelöst davon, wo die Plattform sitzt bzw. wohin sie sich unternehmerisch ausrichtet (grdlg. hierzu Heinze, in: FS Schack, 2022, S. 440).
Daneben mag man sich die Frage stellen, inwiefern ein Wettbewerb der Aufsichtsbehörden, die zumindest de facto ebenfalls zur Regelsetzung bzw. zumindest zur Rechtskonkretisierung beitragen, stattfindet. So soll etwa im DSA und DMA die EU-Kommission eine sehr starke Rolle innerhalb des – von ihr selbst initiierten (!) – Rechtsakts einnehmen. Daneben bleibt es aber bei zuständigen nationalen Behörden. Wohl auch deshalb, weil die Digitalisierung die klassischen Marktgrenzen verwischt und die Gesetzgebung zuletzt eher horizontal statt sektorspezifisch reguliert, ist keineswegs stets von sich aus klar, wer jeweils als aufsichtsrechtlich zuständige Behörde in Betracht kommt. So werden beim AI Act die Datenschutzbehörden oder das BSI bzw. ENISA, i.R.d. Data Act erneut die Datenschutzbehörden, außerdem das BKartA als potentielle “Überwacher” gehandelt.
Hinzu kommt etwa im DSA die zentrale Figur des “Koordinators für digitale Dienste”. Diesbezüglich laufen sich schon jetzt diverse deutsche Behörden warm, wie das Hans-Bredow-Institut in seiner Veranstaltungsreihe “Die Zukunft der Plattformaufsicht” verdienstvoll aufgearbeitet hat (https://hans-bredow-institut.de/de). Es muss sich bei der Behörde, die den Zuschlag erhält, um eine solche handeln, die medien- und netzwerk-, daten- und ggf. kartellrechtliche, vielleicht gar verbraucherschutzrechtliche Kompetenz mitbringt. In Stellung bringen sich hier v.a. die Landesmedienanstalten sowie die Bundesnetzagentur. Letztere hat gewiss eine gewisse Schlagkraft, zumal sie sich bereits mit Themen wie der Netzneutralität sowie mit der Durchsetzung von Geoblocking befasst hat. Demgegenüber wird das Bundesamt für Justiz seltener ernsthaft erwogen, obschon es für das NetzDG zuständig ist. Es gilt aber offenbar zu wenig als prozessgestaltende Regulierungsbehörde.
Außerdem hat Wolfgang Schulz, Direktor des Hans-Bredow-Instituts, die interessante Frage aufgeworfen, ob es verfassungsrechtlich verfängt, dass i.R.d. zur Konvergenz der Materien führenden Plattformregulierung auch die gesellschaftlich relevante Kommunikation mitgeregelt werden darf und ob es insoweit – auch im unionalen Bereich – einen Konflikt mit der Unabhängigkeit von Aufsichtsstellen bzw. dem Gebot der Staatsferne gibt. Hier erscheinen die Landesmedienanstalten freilich besonders unverdächtig.
Prof. Dr. Björn Steinrötter, Potsdam