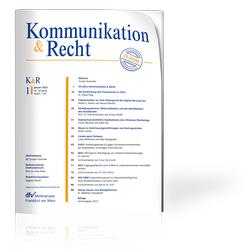"Die spinnen, die Gallier!"
oder: Die Einführung der "Taxe Google" in Frankreich zum 1. 7. 2011

Schon bald nach der massenhaften Verbreitung des Internet stellte die Finanzverwaltung fest, dass bestimmte Dienstleistungen auch digital erbracht werden können. Unter der Überschrift "Sicherstellung der Besteuerung beim Handel über das Internet" verfügte die OFD Münster vor mehr als zehn Jahren (Umsatzsteuer-Information Nr. 45/99 vom 7. 12. 1999, StuB 2000, 48), dass zwischen Offline- und Online-Geschäften zu unterscheiden sei.
Die Erkenntnis, dass es bei reinen Online-Umsätzen zu Lücken in der steuerlichen Erhebung kommen kann, ist somit nicht neu. Schon früh ist daher die Frage behandelt worden, wie die Besteuerung bei Online-Leistungen sichergestellt werden kann (vgl. Schmittmann/Chall, Steuer- und Zollrecht, in: Schiffer/von Schubert, Recht, Wirtschaft und Steuern im E-Business, Abschnitt B. V. Rn. 48 ff., 2002). Zum 1. 7. 2003 wurde in Deutschland die "Bereitstellung von Werbeplätzen" im Internet dem Bestimmungsland-Prinzip unterworfen (vgl. BMF, Schreiben v. 12. 6. 2003 - IV D 1 - S 7117 f-15/03, BStBl. I 2003, S. 375).
An die Stelle der seinerzeitigen 6. EG-Richtlinie ist inzwischen die Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem vom 28. 11. 2006 (ABl. EU Nr. L 347, S. 1, berichtigt: ABl. EU 2007, Nr. L 335, S. 60 - kurz: Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie) getreten, die die größte Einfachheit und Neutralität eines Mehrwertsteuersystems dadurch erreichen will, dass die Steuer so allgemein wie möglich erhoben wird und wenn ihr Anwendungsbereich alle Produktions- und Vertriebsstufen sowie den Bereich der Dienstleistungen umfasst (Erwägungsgrund 5). Erwägungsgrund 17 S. 2 sieht vor, dass als Ort der Dienstleistung grundsätzlich der Ort gelten solle, an dem der Dienstleistende den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat, es könne jedoch angebracht sein, dass insbesondere für bestimmte, zwischen Steuerpflichtigen erbrachte Dienstleistungen, deren Kosten in den Preis der Gegenseite eingehen, als Ort der Dienstleistung der Mitgliedstaat des Dienstleistungsempfängers gilt.
Vor einem Jahr hat eine von dem französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy unter Vorsitz des Künstlers Patrick Zelnik eingesetzte Kommission vorgeschlagen, eine Steuer auf Werbung im Internet einzuführen (Proposition No. 17). Der frühere französische Kulturminister Jacques Toubon, der Mitglied der Kommission war und sich bereits durch das "Loi 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française", das den Gebrauch der französischen Sprache in der Öffentlichkeit regelt, hervorgetan hatte, sprach schnell von einer "Google-Steuer" (französisch: "Taxe Google"). Nicht nur, dass der Namensgeber der Kommission Musikproduzent der Ehefrau des französischen Ministerpräsidenten, Carla Bruni, war, sondern auch, dass die Betreiber von Internetportalen, also insbesondere Google, Abrechnungen über ihre Werbeinnahmen zu erstellen haben werden, stieß auf Widerstand.
Im Rahmen des Haushaltsgesetzes 2011 wurde vorgesehen, dass eine 1%-ige Abgabe auf den "Ankauf von Online-Werbeleistungen" eingeführt wird. Zur Begründung wurde unter anderem vorgebracht, dass der Gesetzgeber der Abwanderung von klassischer Printwerbung in das Internet Rechnung tragen müsse. La Grande Nation rechnet mit Mehreinnahmen von immerhin 10 bis 20 Millionen Euro, die freilich nicht von den Betreibern der meist nicht in Frankreich ansässigen Internetportale zu bezahlen sind, sondern von den in Frankreich ansässigen Internetwerbung buchenden Unternehmen. Man könnte fast meinen, dass der französischen Regierung Internetwerbung so suspekt ist, dass sie mit einer Sonderabgabe belegt werden soll. Es handelt sich - in unserer Terminologie gesprochen - um eine Lenkungssteuer, die auf das Verhalten von Wirtschaftsteilnehmern abzielt. Ob Printwerbung, wichtige Einnahmequelle der Zeitungsverlage, dadurch attraktiver wird, mag mit guten Gründen bezweifelt werden.
Der französische Haushaltsminister François Baroin hat das Projekt vorangetrieben, bis der Vermittlungsausschuss von Nationalversammlung und Senat am 13. 12. 2010 die "Taxe Google" beschlossen hat. Das Gesetz sollte ursprünglich zum 1. 1. 2011 in Kraft treten. Die Assemblée Nationale hat allerdings am 14. 12. 2010 entschieden, dass die "Taxe Google" erst zum 1. 7. 2011 eingeführt werden soll. Die Franzosen werden damit noch ein halbes Jahr Gelegenheit haben, über Sinn und Unsinn der Besteuerung von Onlinewerbung zu diskutieren. Es ist jedenfalls mehr als fragwürdig, eine zusätzliche Steuer einzuführen, die faktisch einer weiteren Umsatzsteuer entspricht und den Werbenden zum Steuerschuldner macht.
Nicolas Sarkozy wäre besser beraten gewesen, wenn er die klassischen Instrumente des Umsatzsteuerrechts genutzt hätte, z. B. durch die Definition des Ortes der sonstigen Leistung oder der Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Durch die Definition des Ortes der sonstigen Leistungen lässt sich ohne weiteres sicherstellen, dass bestimmte Tatbestände im Bestimmungsland besteuert werden. Darüber hinaus kann der Gesetzgeber durch die Umkehr der Steuerschuldnerschaft auch die Steuererhebung optimieren.
Es drängt sich der Eindruck auf, als sei die "Taxe Google" lediglich Ausdruck einer latenten Furcht vor dem Internet und weniger eine Frage der fiskalischen Gerechtigkeit. Über der Côte d'Azur lacht die Sonne, über die "Taxe Google" die ganze Welt.