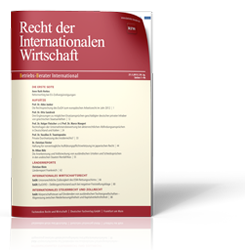OLG Rostock
Internationale Zuständigkeit aufgrund von Konnossementsbedingungen
OLG Rostock, Entscheidung vom 27. November 1996 - 6 U 113/96;
OLG Rostock
vom 27.11.1996
- 6 U 113/96
RIW
1997, 1042
(Heft 12)
Aus den Gründen:»I. Zu Unrecht hat das Landgericht ... die Zulässigkeit der Klage verneint.1. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte folgt aus Ziff. 5 (a) der Konnossementsbedingungen i. V. m. § 38 Abs. 1 ZPO.a) Die Anwendbarkeit des § 38 Abs. 1 ZPO ist nicht wegen einer Vorrangigkeit internationaler Abkommen ausgeschlossen. Das Luganer Übereinkommen gilt erst seit dem 1. März 1995 im Verhältnis zur Schweiz. Es entfaltet keine Rückwirkung auf bereits rechtshängige Klagen (vgl. Art. ...
Sehr geehrter Leser,
Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein,
um das Dokument der Zeitschrift
Recht der internationalen Wirtschaft
zu lesen.
zum Login
Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie
auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen,
dann können Sie die
Zeitschrift sofort freischalten.
Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Recht der internationalen Wirtschaft,
um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen.
Abonnement abschließen.