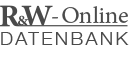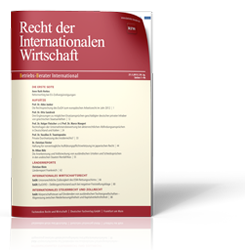Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan: Investitionsschutz oder Dogmatismus?

Freihandelsabkommen schienen nach dem Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump schon aus der Mode gekommen zu sein mit dessen Schwenk zu “America first” – einem noch nicht einmal kaschierten Protektionismus. Doch quasi als Gegenentwurf zu Trumps Abkehr vom Multilateralismus – und dramaturgisch gut gewählt – verkündeten die EU und Japan pünktlich zum Hamburger G-20 Gipfeltreffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländern am 6. 7. 2017 die Einigung auf ein Freihandelsabkommen.
Nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich ist das geplante Japan-EU Economic Partnership Agreement (JEEPA) von größter Bedeutung. Es wäre das derzeit wichtigste EU-Freihandelsabkommen. Die EU und Japan vereinen zusammen ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung. Unmittelbar nach dem Inkrafttreten von JEEPA sollen bereits 90 % aller Zölle entfallen. Japan ist insbesondere bereit, seinen traditionell stark abgeschotteten Agrarmarkt für europäische Produkte zu öffnen, und hat auch zugesagt, bei vielen Waren internationale Standards anzuerkennen und die Einfuhr nicht mehr durch eigene japanische Sonderstandards zu erschweren. Solche Sonderstandards haben sich in der Vergangenheit häufig als nichttarifäre Handelshemmnisse erwiesen, deren einziger Grund darin bestand, Aufwand und Anpassungskosten eines ausländischen Wettbewerbers zu erhöhen. Darauf, dass Japan künftig internationalen Standards zur Sicherheit von Autos folgt, zählt insbesondere die deutsche Automobilindustrie. Im Gegenzug will die EU innerhalb der nächsten sieben Jahre den Zoll von 10 % auf japanische Autos abschaffen.
In Sachen Umweltschutz soll mit der erstmaligen Erwähnung des Klimawandels im Text des Abkommens ein Gegenentwurf zur Leugnung des Klimawandels durch Donald Trump geschaffen werden. Anders als im Falle des auf absehbare Zeit gescheiterten Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) mit den USA fehlen im Verhältnis zu Japan Horrorprodukte wie das berühmt-berüchtigte Wappentier der Anti-TTIP-Bewegung, das Chlorhühnchen. Deutsche Kritiker echauffieren sich zwar darüber, dass der Walfang bei den bisherigen Verhandlungen keine Rolle spielt – als ob ernsthaft damit zu rechnen sei, dass Japan künftig Walfleisch nach Europa exportieren wolle (oder dürfte). Das Vorsorgeprinzip sei auch nicht optimal verankert. Den Perfektionisten und Befürwortern maximaler Transparenz ist es auch ein Dorn im Auge, dass offizielle Dokumente der seit vier Jahren andauernden Verhandlungen nicht unmittelbar veröffentlicht werden, sondern erst über Wikileaks ins Netz gelangten.
Dennoch könnte alles auf eine rasche abschließende Verständigung und Unterzeichnung des JEEPA hinauslaufen, wenn es nicht die Frage des Streitbeilegungsmechanismus gäbe. Die EU-Kommission hat – möglicherweise etwas vollmundig – klassische Streitbeilegung durch Schiedsgerichte für tot erklärt und will nun im JEEPA unbedingt einen weiteren Anwendungsfall des von ihr propagierten – aber noch wenig durchdachten – Investitionsgerichtshof durchsetzen, der allein mit staatlich bestellten Richtern besetzt sein soll. Japan zeigt sich sehr zögerlich, fürchtet man doch, hier einen Präzedenzfall zu schaffen, auf den sich später auch potentielle Handelspartner wie die VR China berufen könnten. Solche Bedenken teilt die EU nicht. Zur Überraschung europäischer Investoren sollen für den im Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam vorgesehen Investitionsgerichtshof ein Drittel der Richter von dem Einparteienstaat Vietnam bestellt werden. Es bedarf nicht erst der Auftragsentführung eines Geschäftsmannes aus Berlin, um zu erkennen, dass der Respekt des internationalen Rechts in autoritären Staaten nicht immer besonders ausgeprägt ist (s. FAZ v. 23. 9. 2017, S. 6: “Weiterer Diplomat ausgewiesen, Berlin: Verhalten Vietnams völlig inakzeptabel”). Das aktuelle System der Schlichtung von Investitionsstreitigkeiten durch ICSID macht es den Streitparteien praktisch unmöglich, Schiedsrichter der eigenen Staatsangehörigkeit zu bestellen. Andere angebliche Vorteile, die für die bilateralen Investitionsgerichtshöfe ins Felde geführt werden (Transparenz, Vorhersehbarkeit, Qualität der Entscheider) überzeugen nicht oder wären unschwer auch mit dem bewährten Modell zu erreichen. Die Überführung solcher bilateraler Investitionsgerichtshöfe in ein angestrebtes Welthandelsgericht bleibt in einer Zeit, in der dem Protektionismus das Wort geredet wird, Zukunftsmusik. Dies auch schon deswegen, weil die EU-Kommission keine ausschließliche Kompetenz hat, solche Regelungen ohne die nationalen und regionalen Parlamente (einschließlich Wallonien) zu erlassen. Umso mehr darf man sich darüber wundern, dass die Kommission für das JEEPA bereit ist, die Frage des Streitbeilegungsmechanismus zum Stolperstein werden zu lassen. Japan ist noch nie von ausländischen Investoren verklagt worden. Japanische Investoren haben erst zweimal gegen ausländische Gaststaaten geklagt. Deutsche Investoren – gerade auch aus dem Mittelstand – haben dagegen die Möglichkeit der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit in der Vergangenheit häufig und mit Erfolg genutzt. Die Hysterie, mit der dieses System zuletzt ausgerechnet in Deutschland in Frage gestellt wurde (überwiegend wegen der eingereichten, aber noch gar nicht entschiedenen Klage des schwedischen Investors Vattenfall gegen Deutschland) ist daher nur schwer begreiflich. Dass die EU nun bereit ist, das JEEPA aus dogmatischen Gründen an der Frage des Streitbeilegungsmechanismus scheitern zu lassen, lässt am Fingerspitzengefühl der sich als “politisch” verstehenden Kommission von Jean-Claude Juncker zweifeln. Aber daran zweifeln auch die, die Junckers Vorschläge aus seiner Rede zur Lage der EU vom 13. 9. 2017 mit der (ggf. subventionierten) Einführung des Euro in allen Mitgliedstaaten und der Erweiterung des Schengen-Abkommen nach Osten nicht für hilfreiche Antworten auf Euro-Skepsis und Sorge vor offenen Grenzen erachten (vgl. H.-W. Sinn, “Mit Volldampf ins Chaos”, Handelsblatt v. 29. 9. 2017, S. 48). Politische Träumereien mögen erlaubt sein – in Kombination mit Dogmatismus sind sie gefährlich für europäische Investoren.
Dr. Stephan Wilske, Rechtsanwalt, Stuttgart