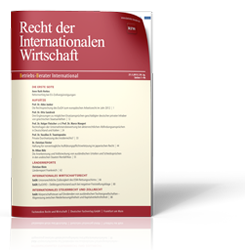Richtlinienkonforme Auslegung nationalen Rechts

Es ist manierliche Pflicht der Gerichte, das einfache Recht gehörig anzuwenden und auszulegen. Das BVerfG kann richterliches Wirken mitsamt der gebrauchten Auslegungsmethode indes nicht erschöpfend auf Richtigkeit durchleuchten und ist bei seiner Prüfung sogar auf die Verletzung wesensgemäßen Verfassungsrechts begrenzt. Bei der Inaugenscheinnahme richterlicher Kompetenzgrenzen erforscht das BVerfG folgerichtig nur, ob das Fachgericht bei seiner Rechtsfindung den gesetzgeberischen Programmsatz hinlänglich beachtet und von den anerkannten Methoden der Gesetzesdeutung tauglichen Gebrauch gemacht hat.
Gewaltenteilung schließt aus, dass Gerichte Befugnisse beanspruchen, mit denen die Verfassung ausschließlich den Gesetzgeber beliehen hat. Die Verfassungsdirektiven versagen es dem Richter zwar nicht, das Recht fortzuentwickeln. Anlass zu richterlicher Rechtsfortbildung besteht immer dann, wenn Lücken zu schließen oder widersinnige Wertungen aufzulösen sind. Dem Auftrag zur schöpferischen Findung und Fortbildung des Rechts sind freilich wegen der unverzichtbaren Gesetzesbindung der Rechtsprechung Schranken gesetzt. Richterliche Rechtsfortbildung darf nicht dazu führen, dass der Richter seine eigene Gerechtigkeitsauffassung an die Stelle derjenigen des Gesetzgebers setzt. Ein Richterspruch setzt sich aber dann über die Gesetzesbindung hinweg, wenn die vom Gericht bemühten Denkübungen augenfällig erkennen lassen, dass es partout nicht bereit war, sich Recht und Gesetz zu fügen.
Dabei hat das BVerfG seine Überlegungen unabhängig davon anzustellen, ob das einfache nationale Recht der Umsetzung einer Richtlinie der Europäischen Union dient oder nicht. Der Kanon der Unionstreue verpflichtet alle mitgliedstaatlichen Gerichte, diejenige Deutung des nationalen Rechts zu wählen, die dem Inhalt einer EU-Richtlinie in der jeweiligen Lesart des EuGH entspricht. Die unionsrechtliche Pflicht zur richtlinienkonformen Auslegung verpflichtet das nationale Gericht zu einem richtlinienkonformen Ergebnis. Besteht ein Auslegungsspielraum, ist das nationale Gericht gehalten, diesen soweit wie möglich auszuschöpfen. Mehrere tunliche Auslegungsmethoden sind darum zur Erreichung des Richtlinienziels bestmöglich anzuwenden (dazu jüngst EuGH, RIW 2012, 236 – Dominguez).
Die auslegende Verwirklichung des Richtlinienziels findet seine Grenzen in dem nach innerstaatlicher Rechtstradition methodisch Statthaften. Einsichtsvoll ersucht der EuGH das nationale Gericht nur, das innerstaatliche Recht soweit wie möglich nach Wortlaut und Zweck der Richtlinie auszulegen, um das in ihr festgelegte Ergebnis zu erreichen. Der EuGH anerkennt auch, dass die Pflicht zur gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung durch den Grundsatz der Rechtssicherheit beschränkt wird und daher keinesfalls zur Auslegung wider das Gesetz animieren darf (EuGH, RIW 2012, 236 Rdnr. 25 – Dominguez). Inwieweit das innerstaatliche Recht eine richtlinienkonforme Auslegung zulässt, können wiederum nur innerstaatliche Gerichte beurteilen. Da der EuGH folglich nationales Recht weder anwenden noch auslegen kann, ist ihm auch die Feststellung verwehrt, ob innerstaatlicher Auslegungsspielraum besteht. Die Wahrnehmung methodischer Bewegungsfreiheiten des nationalen Rechts kommt auch bei dem durch Richtlinien vorgegebenen nationalen Recht ausschließlich den nationalen Stellen in den Grenzen des Verfassungsrechts zu.
Soweit der aus dem deutschen Verfassungsrecht gewonnene Befund. Wie dehnbar, ergänzungsfähig, wandelbar und änderungsfest er ist – das stellt der EuGH gelegentlich – betrachtet man etwa das Urteil Schultz-Hoff (EuGH, RIW 2009, 163) und seine verheerenden Nachwehen auf einen gewöhnungsbedürftigen Prüfstand. Wie auch immer – EuGH und BVerfG sollten alles andere als eine judikatorische Bedarfsgemeinschaft sein.
Volker Wagner, Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeitsrecht, Gießen