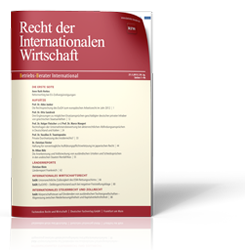LG Bonn
Staatshaftung wegen verspäteter Umsetzung der Einlagensicherungsrichtlinie
LG Bonn, Entscheidung vom 16. April 1999 - 1 O 186/98;
LG Bonn
vom 16.04.1999
- 1 O 186/98
RIW
2000, 384
(Heft 5)
SachverhaltDie Klägerin macht Schadensersatz wegen verspäteter Umsetzung der EG-Richtlinie 94/19/EWG vom 30. 5. 1994 geltend. Die Einlage wurde noch vor dem 1. 7. 1995, d. h. vor Ablauf der Umsetzungsfrist, von der Klägerin bei der B. Bank erbracht. Die B. Bank gehörte keinem Einlagensicherungssystem an, das damals auch noch nicht gesetzlich vorgeschrieben war. Die Nichtverfügbarkeit (= Entschädigungsfall) infolge Zahlungsunfähigkeit der B. Bank trat nach dem 1. 7. 1995 ein. Die Bundesrepublik ...
Sehr geehrter Leser,
Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein,
um das Dokument der Zeitschrift
Recht der internationalen Wirtschaft
zu lesen.
zum Login
Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie
auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen,
dann können Sie die
Zeitschrift sofort freischalten.
Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Recht der internationalen Wirtschaft,
um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen.
Abonnement abschließen.