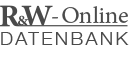Antragspflicht in der Krise!
von Sebastian Voitzsch, Münster

Antragswirrwarr
Als im letzten Frühjahr deutlich wurde, dass die durch die Corona-Krise hervorgerufenen Lockdowns zu erheblichen Einschränkungen für zahlreiche Unternehmen führen würden, wurde ebensoschnell klar, dass einerseits nur wenige Unternehmen eine hinreichende Kapitalausstattung aufweisen, um einen solchen Lockdown zu überstehen. Und andererseits würden selbst eiligst aufgelegte Hilfsprogramme eine Anlaufzeit benötigen, bis sie greifen; ob sie schließlich dort ankommen und so wirken, wie man es beabsichtigt, steht dabei noch auf einem ganz anderen Blatt.
Um die geplagten Unternehmen weiter zu entlasten, entschloss man sich daher, die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrages auszusetzen. Damit wurden Geschäftsführer von der Pflicht entbunden, in einer Situation, in der das Unternehmen aus eigener Kraft nicht überlebensfähig ist, ein geordnetes Verfahren einzuleiten, in dem zunächst durch einen Sachverständigen geprüft wird, ob tatsächlich Gründe für die Einleitung eines Insolvenzverfahrens bestehen. Bejaht er diese Frage, empfiehlt er im zweiten Schritt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, in welchem verschiedene Mittel zur Verfügung stehen, um angeschlagene Unternehmen zu sanieren oder auch kontrolliert abzuwickeln, wenn sich herausstellt, dass die Ursache der Krise langfristig nicht zu beseitigen ist.
Die Aussetzung der Antragspflicht ist dabei nur verständlich, wenn man das Insolvenzverfahren als Verfahren zur Abwicklung und Zerschlagung versteht. Dann lässt sich nachvollziehen, dass die Einleitung eines Verfahrens vermieden werden soll, an dessen Ende unweigerlich die Abwicklung des Unternehmens steht – und das aufgrund einer völlig unverschuldeten externen Ursache (im Falle von Corona gar als Sonderopfer für die Gesellschaft).
Begreift man indes das Insolvenzverfahren als umfassenden Sanierungsprozess, der zwar seinen Ausgangspunkt in der Feststellung hat, dass ein Unternehmen in der aktuellen Situation – unabhängig von deren Ursache – wirtschaftlich nicht überlebensfähig ist, in dieser Krisensituation aber zahlreiche Möglichkeiten – von der Eigenverwaltung über das Schutzschirmverfahren bis hin zum Insolvenzplanverfahren – anbietet, um das Unternehmen neu aufzustellen und dann wieder in den Markt zu entlassen, dann ist die Aussetzung der Antragspflicht nicht nachvollziehbar.
Dem mag man entgegenhalten, dass die Aussetzung der Pflicht nicht gleichbedeutend ist mit der Möglichkeit, freiwillig einen Antrag zu stellen. Indes: schon mit geltender Antragspflicht läuft der Geschäftsführer, der „zu frühzeitig“ einen Antrag stellt, Gefahr, sich eines Schadensersatzanspruches der Gesellschafter auszusetzen. Denn die Rechtsprechung geht davon aus, dass allein die Einleitung eines Insolvenzverfahrens nachteilige Auswirkungen auf die weitere Geschäftstätigkeit hat – eine Art „Rufschädigung“. Sieht nun das Gesetz eine Verpflichtung, den Antrag zu stellen, trotz einer handfesten Krise nicht vor, dürfte kaum eine Möglichkeit für „vorsichtige“ Geschäftsführer bleiben. Die Entscheidung über so wesentliche Entscheidungen ist kaum eine des laufenden Geschäftsbetriebs und damit also der Gesellschafterversammlung vorbehalten. Verbieten die Gesellschafter die Antragstellung, scheidet diese Möglichkeit aus. Der Verweis auf einen „freiwilligen“ Antrag lässt zudem den Geschäftsführer auch mit dem Risiko allein, die Situation richtig einzuschätzen. Regelmäßig wird über die Fragen, ob ein Insolvenzgrund vorlag und ob die Voraussetzungen einer Aussetzung der Antragspflicht vorlagen, erst im Nachhinein entschieden. Stellt sich dann heraus, dass die Einschätzung des Geschäftsführers fehlerhaft war, ist es zu spät. „Unkenntnis schützt vor Strafe nicht“ lautet eine Binsenweisheit, die gerade im Insolvenzrecht mit voller Härte (und vor allem in voller Höhe) zuschlagen kann. Insofern sollte man nicht die Angst vor der Antragstellung kultivieren, indem die Pflicht, einen Antrag zu stellen, aufgeweicht und immer wieder mit immer unklarer werdenden Vorgaben ausgesetzt wird. Wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen Insolvenzgrund erkenntlich machen, bleibt es bei der Antragspflicht. Ursachenforschung und die Wahl der Mittel zu deren Beseitigung erfolgen dann im Insolvenzverfahren, das geeignete Werkzeuge dafür zur Verfügung stellt.

Sebastian Voitzsch ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Nach zweijähriger Tätigkeit in einer ehemaligen OLG-Kanzlei, die seine vorhandene Vorliebe für alle Bereiche der Prozessführung weiter verstärkt hat, gehört er seit 2009 zum Team der MÖNIG Wirtschaftskanzlei. Hier vertritt er die Bereiche (Insolvenz-)Arbeits- und Prozessrecht. Da der beste Prozess, der ist, der nicht geführt werden muss, berät und vertritt er Mandanten auch ohne bzw. zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen.