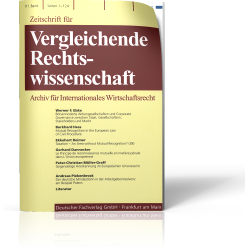Statut des Weltstrafgerichtshofs in Kraft: Justitia contra Supermacht – oder: das freie Spiel der Kräfte?
Mit dem am 1. Juli 2002 in Kraft getretenen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs hat eine wenn auch langsame, so doch stetig voranschreitende Entwicklung ihre Vollendung gefunden, die mit den Kriegsverbrecherprozessen von Nürnberg und Tokio begonnen und mit den Tribunalen für Jugoslawien und Ruanda fortgesetzt wurde. Auch wenn diese Tribunale stets aus einer historischen Sondersituation entstanden sind, ihre Einrichtung nicht dauerhaft und ihr Auftrag sowohl räumlich als auch zeitlich begrenzt war, müssen sie als Vorläufer des jetzigen Weltstrafgerichtshofs angesehen werden. Denn die Intention, die der Schaffung des jeweiligen Gerichtshofs damals wie auch heute zu Grunde lag, ist die gleiche: die Bestrafung der für Völkermorde, schwere Kriegsverbrechen und andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht Verantwortlichen im Geiste einer internationalen Solidarität mit dem Ziel, Strafbarkeitslücken abzuschaffen und ein friedlicheres und gerechteres Zusammenleben der Völker zu sichern.
Mit der Schaffung des Weltstrafgerichtshofs haben die Staaten auf einem der sensibelsten und schwierigsten Gebiete des Völkerrechts, dem Völkerstrafrecht, nunmehr ihre Bereitschaft zur zwischenstaatlichen Kooperation nach außen manifestiert. Den Grundstein für die Errichtung dieses ersten dauerhaften und länderübergreifenden Strafgerichtshofs legte 1988 eine Konferenz von 120 Staaten, die in Rom das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs annahmen. Allerdings gingen Fachleute damals davon aus, dass das In-Kraft-Treten des Statuts noch eine sehr lange Zeit auf sich warten lassen würde, da es von mehr als 60 Staaten ratifiziert werden musste. Aber die Mehrzahl der Staaten hatte ein anderes Bewusstsein: Sie sahen die Notwendigkeit eines Weltstrafgerichtshofs, um der Welt eine stabilere Struktur zu geben. Und so trafen sich am 11. April 2002 Diplomaten von 60 Staaten, um in einer Feierstunde, in der zehn Staaten gleichzeitig ihre Ratifikationsurkunden hinterlegten, die Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs zu würdigen.
Dieser historische Moment, vom Vorsitzenden der Vorbereitungskommission für den Gerichtshof Philippe Kirsch (Kanada) als Verwirklichung des das Zeitalter der Straflosigkeit ablösenden Traums von internationaler Gerechtigkeit für alle bezeichnet, sollte einen Meilenstein im internationalen Recht, einen elementaren Schritt zur Weiterentwicklung des Völkerrechts kennzeichnen. Aber: Wie so häufig im Leben folgt der Euphorie die Ernüchterung: Denn spätestens seitdem die Regierung Bush am 6. Mai 2002 die in letzter Se¬
Diese ablehnende, vermeintlich widersprüchliche Haltung der USA erklärt sich vor dem Hintergrund, dass die vom Internationalen Strafgerichtshof angestrebte Gerechtigkeit den Regeln des Völkerstrafrechts folgt, während die USA nicht nur ihre Kriege nach ihren eigenen Regeln geführt haben, ohne zur Verantwortung gezogen werden zu können, sondern auch den Begriff „Gerechtigkeit“ entsprechend ihrem politischen Verständnis definiert haben. Diese Sonderstellung ist gefährdet, wenn mit dem Tätigwerden des Weltstrafgerichtshofs eine universelle, dann übergeordnete Institution über Kriegshandlungen auch von US-Amerikanern zu Gericht sitzen und verantwortliche Einzelpersonen aburteilen kann. Aus diesem Grund haben die USA auf ihre – zunächst erfolglose – Forderung nach Immunität für US-Friedenssoldaten mit einem „Gesetz zum Schutz der Mitglieder der amerikanischen Streitkräfte“ reagiert, das den Präsidenten ermächtigt, einen vor dem Strafgerichtshof stehenden US-Bürger mit militärischer Gewalt befreien zu lassen.
Zwar hat es derzeit den Anschein, dass diese erneute Machtdemonstration seitens der USA von Erfolg gekrönt war, da am 12. Juli 2002 vom Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet wurde, nach der Staatsangehörige von Ländern, die den Strafgerichtshof ablehnen, befristet auf zwölf Monate keine Ermittlung und Strafverfolgung befürchten müssen. Ob dieser Kompromiss in der Immunitätsfrage der US-amerikanischen Soldaten allerdings tatsächlich zu einem Obsiegen der Amerikaner führen wird, liegt in der Hand der Staatengemeinschaft, die heute mehr denn je aufgerufen ist, sich auf ihre Stärke zu besinnen: die Solidarität in ihrem Willen zur zwischenstaatlichen Zusammenarbeit auch auf dem Gebiet des Strafrechts mit dem Ziel, den Traum von Rechtssicherheit weltweit zu verwirklichen. Diese Kooperation ist umso schlagkräftiger, weil auch die USA in einer wirtschaftlich, politisch und auch rechtlich immer stärker zusammenwachsenden Welt einen wenn auch bedeutenden, so doch eben nur einen Teil eines Gesamtgefüges bilden, das von gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt ist. Hinzu kommt, dass – wie uns die Geschichte mehr als ein Mal gelehrt hat – grenzenlose Machtausübung unter Missachtung internationaler Abkommen und Grundprinzipien des Rechts¬
Auch wenn sich der Einwand der Amerikaner, der Gerichtshof beschränke ihre Souveränität, nicht leugnen lässt, da mit der Gründung jeder internationalen Institution der teilweise Souveränitätsverlust der Staaten einhergeht, so kann er doch bezogen auf den Gerichtshof nicht überzeugen. Denn nach dem Statut ist das Gericht nur zuständig, wenn die Staaten nicht willens und nicht in der Lage sind, schwerste Verbrechen selbst zu verfolgen; sie entscheiden somit allein, ob sie ihre Hoheitsgewalt an ein internationales Gremium abtreten oder nicht.
Ferner lässt sich zwar auch das Kernargument, dass US-Soldaten und Politiker in ihrer Funktion als „Weltpolizei“ Opfer politisch motivierter Anklagen werden könnten, nicht generell in Abrede stellen. Allerdings übersehen die Amerikaner in diesem Zusammenhang, dass diese Gefahr eines Missbrauchs bereits heute besteht, da nach dem geltenden Völkerrecht ein Land Verbrechen von Ausländern auf seinem Boden ahnden darf und damit stets die Möglichkeit einer fingierten Anklage besteht. Dann aber erscheint es zweckmäßig, solche Verfahren nicht vor einem nationalen Gericht zu führen, das die politisch geprägte Rechtsordnung anzuwenden hat, sondern vor einem unparteiischen, unabhängigen Tribunal.
Diese Unparteilichkeit und Unabhängigkeit, die nicht zuletzt durch die Suspendierung von nationalen Dienstpflichten und die Verleihung von Immunitäten gewährleistet werden, bilden nicht nur die integralen Kriterien der richterlichen Funktion allgemein, sondern sind Zeichen der Stärke, die der Weltstrafgerichtshof im freien Spiel der Kräfte gegen Skeptiker einsetzen kann, um – wenn auch vielleicht in einer ferneren Zukunft – Urteile im Namen der Völker verkünden zu können.
Rechtsanwältin Dr. Martina Koster, Heidelberg