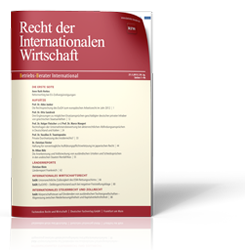OLG Koblenz
Anerkennung und Vollstreckbarkeit eines Urteils aus dem US-Staat Oregon
OLG Koblenz, Entscheidung vom 16. Oktober 2003 - 7 U 87/00;
OLG Koblenz
vom 16.10.2003
- 7 U 87/00
RIW
2004, 302
(Heft 4)
SachverhaltDie Beklagte hat aufgrund eines 1983 unter Vermittlung einer Firma K. Inc. zustande gekommenen Vertrages die Firma J. K. Co. (im Folgenden: J. K.) mit Keramikfliesen für ein Bauvorhaben in Portland, im US-Bundesstaat Oregon, beliefert. Diese erwirkte ein Urteil des United States District Court for the District of Oregon in Portland vom 30. 11. 1987, durch welches die Beklagte und die Firma K. Inc. zur Zahlung von 1 307 175,40 US $ nebst 6,04 % Zinsen seit dem 31. 3. 1987 sowie ...
Sehr geehrter Leser,
Sie sind zur Zeit nicht angemeldet. Bitte loggen Sie sich ein,
um das Dokument der Zeitschrift
Recht der internationalen Wirtschaft
zu lesen.
zum Login
Sind Sie bereits Leser der Zeitschrift und möchten Sie
auch die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift nutzen,
dann können Sie die
Zeitschrift sofort freischalten.
Bestellen Sie ein Abonnement für die Zeitschrift Recht der internationalen Wirtschaft,
um die R&W-Online Datenbank dieser Zeitschrift zu nutzen.
Abonnement abschließen.