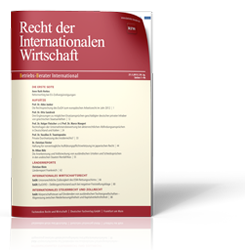Entgelttransparenz 4.0: Wenn die “einheitliche Quelle” das ganze System kippt


Die Autoren
Dr. Dominik Sorber, RA, als Fachanwalt für Arbeitsrecht ist der Schwerpunkt seiner Tätigkeit die strategische Beratung auf dem Gebiet des Betriebsverfassungsrechts sowie der Betriebsrat-Compliance. Besondere Expertise hat er in der Beratung zur Entgelttransparenz.
Dr. Michaela Felisiak, LL.M., RAin, als Fachanwältin für Arbeitsrecht ist der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit die Beratung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten sowie unterschiedlicher Compliance-Themen. Hierzu gehört insbesondere die Beratung zur Entgelttransparenz.
Die neue EU-Entgelttransparenzrichtlinie (RL (EU) 2023/970) bringt nicht nur mehr Pflichten, sondern stellt ganze Vergütungssysteme in Konzernen infrage – und das mit einer rechtlichen Schärfe, die bislang nur aus der DSGVO bekannt war.
Aufgepasst – sie kommt. Und sie kommt mit Wucht. Die neue EU-Entgelttransparenzrichtlinie (RL (EU) 2023/970) bringt nicht nur mehr Pflichten, sondern stellt ganze Vergütungssysteme in Konzernen infrage – und das mit einer rechtlichen Schärfe, die bislang nur aus der DSGVO bekannt war. Im Zentrum steht ein Begriff, der nur Feinschmeckern der EuGH-Rechtsprechung bekannt sein dürfte: die “einheitliche Quelle”. Wer jetzt noch denkt, es gehe nur um klassische Diskriminierungsfälle innerhalb eines Standorts, wird bald eines Besseren belehrt: Der Kreis vergleichbarer Arbeitnehmer weitet sich aus – zeitlich, sachlich und strukturell. Und mit ihm wachsen Rechtsunsicherheiten, Offenlegungspflichten und Compliance-Risiken.
Die neue Vergleichsdimension wirft die Frage auf: Wer macht jetzt die Regeln? Nach Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie ist für die Vergleichbarkeit nicht länger entscheidend, ob zwei Beschäftigte beim selben Arbeitgeber tätig sind. Maßgeblich ist vielmehr, ob ihre Entgeltbedingungen von derselben “einheitlichen Quelle” stammen – also von einer Stelle, die die Gehaltsstruktur einheitlich über eine Organisationsform festlegt und auch wieder verändern kann.
Diese Quelle kann vieles sein:
-
eine Konzernmuttergesellschaft,
-
eine zentrale Personalabteilung,
-
ein konzernweiter Haustarifvertrag,
-
ein kollektivrechtlich bindender Rahmen oder
-
gesetzliche Besoldungsregelungen.
Selbst wenn zwei Beschäftigte in unterschiedlichen Unternehmen, Ländern oder Zeiträumen arbeiten, kann ein Vergleich zulässig sein – solange ihre Vergütung auf dieselbe Quelle zurückzuführen ist. Erwägungsgrund 29 bringt es auf den Punkt: Eine einheitliche Quelle liegt z. B. vor, “wenn die Bedingungen für mehr als eine Organisation oder mehr als einen Betrieb einer Holdinggesellschaft oder eines Konzerns zentral festgelegt werden”.
Damit steht fest: Nationale Regeln stehen auf dem Prüfstand. Die neue Rechtslage steht damit in direktem Widerspruch zu § 4 Abs. 3 EntgTranspG, der Beschäftigte in unterschiedlichen Rechtsverhältnissen als nicht vergleichbar einstuft. Diese Vorschrift wird unionsrechtswidrig, soweit sie Personengruppen ausblendet, die unter dieselbe steuernde Instanz fallen. Die Richtlinie kennt keine Ausnahme von dem weiten Verständnis der einheitlichen Quelle – weder bei der Rechtsform, noch bei der Organisationseinheit oder dem Arbeitsverhältnis. Damit geraten zentral gesteuerte Entgeltsysteme in den Fokus gerichtlicher Überprüfbarkeit – konzernweit, grenzüberschreitend und in der gesamten EU.
Ein weiterer neuer Grundsatz ist zu beachten: Gleichheit in der Zeit – und das ohne reale Vergleichsperson. Noch gravierender ist: Ein Vergleich ist auch dann zulässig, wenn die Vergleichsperson gar nicht mehr existiert. Art. 19 Abs. 2 der Richtlinie erlaubt ausdrücklich den zeitlich versetzten Vergleich – und sogar den Rückgriff auf hypothetische Vergleichspersonen. Das bedeutet: (i) Wird eine vormals hoch vergütete Position nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers niedriger bewertet, muss das begründet werden. (ii) Besteht ein strukturelles Lohngefälle zwischen zwei stark geschlechtlich segregierten Berufsgruppen, können statistische Indizien ausreichen, um eine Diskriminierung zu vermuten. Das Bundesarbeitsgericht war hier bislang restriktiver – es forderte über bloße Statistik hinausgehende Anhaltspunkte. Diese Rechtsprechung dürfte auf europäischer Ebene kaum Bestand haben.
Und damit nicht genug – auch die Verantwortung ist künftig mehrdimensional: Denn Offenlegung, Beweislast und Rechtsdurchsetzung verändern sich signifikant. Es kommt zu einem neuen prozessualem Ungleichgewicht: Art. 18 der Richtlinie verlagert die Beweislast bei Indizien für Entgeltdiskriminierung auf den Arbeitgeber. Art. 20 verpflichtet zur Offenlegung einschlägiger Beweismittel – auch dann, wenn sie sich nur im Einflussbereich des Arbeitgebers befinden. Und Kapitel 3 der Richtlinie etabliert neue Klagerechte, Verbandsklagen und Sanktionsmöglichkeiten. Was das bedeutet? HR-Governance wird zur Rechtsfrage, zentral gesteuerte Vergütungssysteme werden zur justiziablen Angriffsfläche – vor allem dort, wo keine Tarifbindung besteht (Spoiler: auch diese sind nicht vor der EU-Entgelttransparenzrichtlinie sicher!) und Arbeitgeber*innen in der Vergangenheit freie Hand bei der Gehaltsgestaltung hatten.
Unser Fazit dazu lautet: Die Quelle verpflichtet – und das über Grenzen hinweg. Das neue europäische Transparenzrecht verschiebt die Verantwortung dorthin, wo die Regeln gemacht werden. Für international tätige Unternehmen ist die Entgelttransparenzrichtlinie kein nationales Umsetzungsprojekt, sondern eine konzernweite Compliance-Herausforderung. Wer Vergütungssysteme steuert, übernimmt künftig auch die Verantwortung für ihre Angreifbarkeit. Mit der “einheitlichen Quelle” hält ein neues Verständnis von Gleichbehandlung Einzug in die Arbeitswelt – eines, das nicht am Werkstor endet. Das ist Entgelttransparenz 4.0. Und Fair Pay ist damit nicht nur der Titel unseres Podcasts zur Umsetzung der Richtlinie, sondern beschreibt die neue Realität für Unternehmen.
Dr. Dominik Sorber und Dr. Michaela Felisiak, beide München