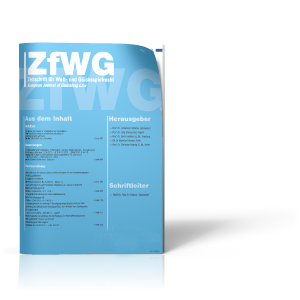Das Glücksspiel: eine Chimäre?

Gibt es eigentlich „Glücksspiel“? Zugegeben: Die Frage erscheint einigermaßen kühn, zumal in einer Zeitschrift, die den Begriff „Glücksspiel“ im Namen führt. Umgekehrt gilt freilich auch, dass wesentliche Voraussetzung allen wissenschaftlichen Arbeitens ist, auch scheinbar gesicherte Annahmen in Frage zu stellen. Und die ZfWG versteht sich als wissenschaftliche Zeitschrift. Was nun das Sein oder Nichtsein des „Glücksspiels“ angeht, so sind es Daniel Henzgen, ein exzellenter Kenner der Branche, sowie Dominik Meier, die die Frage in ihrem neuen tiefschürfenden Werk „Der Mensch, das Spiel und der Zufall“ (Wiesbaden 2024) aufgeworfen haben. Ihre Antwort ist ebenso klar wie spektakulär: Nein, „das Glücksspiel“ gibt es nicht! Und zwar deshalb nicht, weil es „das Glück“ im Singular nicht gibt. „Die menschlichen Ideale und Konzepte zum Wohlergehen, Gunst, Gelingen, Zufall und Fügung“, so die Autoren, „sind irreduzibel divers – und sie sind immer je schon eingebettet in ein historisch-kulturelles Gesamtsystem von Werten, Überzeugungen und Machtverhältnissen“ (S. 197). In der Tat ist die dem deutschen Terminus eigene Begriffsverbindung von „Glück“ und „Spiel“ ebenso rätselhaft wie singulär. Blickt man auf die Geschichte des „Glücksspiels“, fungierte das Würfelspiel über Jahrtausende als Prototyp und Namensgeber für alle Formen des zufallsabhängigen Spiels. Nicht nur bei den alten Griechen („kubeia“), sondern auch im antiken Rom, wo das lateinische Wort „alea“ für „das Glücksspiel“ insgesamt stand. Die frühen, auf das 3. Jahrhundert vor Christi datierbaren „Glücksspiel“-Gesetze der Römer firmierten denn auch als „leges aleariae“ (Würfelgesetze). Freilich erwies sich der prohibitive Ansatz schon damals als wenig erfolgreich. „Habet et alea suas leges, quas fori iura non solvant“, heißt es bei Ambrosius (De Tobia Cap. VIII, 38). Gesetze scheitern im Vollzug. Nichts Neues unter der Sonne also. Im europäischen Ausland finden sich anstelle der dem deutschen Recht eigenen Verbindung von Glück und Spiel Begriffsbildungen unter Betonung des Zufallselements (Hasard), etwa beim spanischen „juego de azar“, dem italienischen „gioco d’azzardo“, dem französischen „jeu de hasard“ oder beim dänischen „hasardspil“. Freilich finden auch diese Begriffsbildungen ihre etymologische Herleitung aus dem vertrauten Würfel (arab. „al-azar“). Eher positiv konnotiert scheint der Begriff des „gambling“ im anglo-amerikanischen Sprachraum. Er wird auf den mittelenglischen Begriff „gammlen“ zurückgeführt, der wiederum in sprachlicher Verwandtschaft zum „gaming“ für das gemeinsame Spielen und Scherzen steht, allerdings auch für Risiko und Wagnis, die – je nach Mentalität – freilich ebenfalls beide als Tugenden gedeutet werden können. Wie aber erklärt sich vor diesem Hintergrund die so anders geartete Begrifflichkeit im deutschen Sprachraum; und welches „Glück“ ist überhaupt gemeint? Das „Glück“, das in dem lockenden Gewinn liegt? Das „Glück“, das im Spiel selbst bzw. der kurzzeitigen Hoffnung auf ein besseres Leben liegt? Das „Glück“, das über Gewinn oder Verlust entscheidet? Oder steht die Verknüpfung von Glück und Spiel genau umgekehrt für den unterschwelligen, schon von Cicero erhobenen Vorwurf an die „aleatores“ und „Hazardeure“, leichtfertig das eigene „Glück“ auf’s Spiel zu setzen? Frei nach Albert Einsteins berühmten Ausspruch: „Gott würfelt nicht“. Diese Interpretation läge auf einer Linie mit der unter Ökonomen zunehmend kritisch bewerteten Kategorisierung des „Glücksspiels“ als „demeritorisches Gut“. Wie auch immer: Für die Einschätzung von Henzgen und Meier, wonach der deutsche Begriff des Glücksspiels „letztlich eine extreme Verdichtung diskursiver historischer Auseinandersetzungen um die wahren, guten oder richtigen Lebensführungsstile dar(stellt)“ (S. 21), sprechen starke Argumente. Vor allem erklärt sie die Vieldeutigkeit des Begriffs als „Netz von Verweisen“, wie es die Dekonstruktionslehre formulieren würde. Am Ende geht es zumeist um Machtfragen. Und wer die Definitionshoheit über Begriffe hat, der herrscht über das Denken. Was aber heißt das nun konkret? Gibt es also das „Glücksspiel“ gar nicht und muss die ZfWG womöglich umbenannt werden? Hier kann – zumindest vorerst – Entwarnung gegeben werden. Juristen haben es leicht. Ihr Bezugsobjekt sind die Gesetze. Und wenn diese von „Glücksspiel“ sprechen, dann ist die Verwendung dieses (Rechts-) Begriffs in jeder Hinsicht
Univ.-Prof. Dr. Johannes Dietlein, Düsseldorf*
| * | Auf Seite III erfahren Sie mehr über den Autor. |