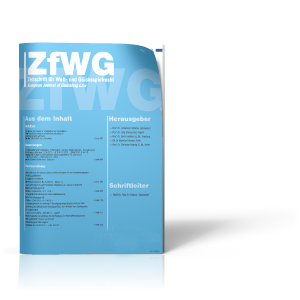Das Prohibitionsdilemma – nur ein Phantom?

Die Glücksspielregulierung in Deutschland steht vor einem grundlegenden Paradoxon: Je stärker der Gesetzgeber das legale Angebot – etwa im Bereich der terrestrischen Geldspielgeräte – reguliert, desto unattraktiver wird dieses Angebot und entsprechend attraktiver der unregulierte illegale Markt. Dieses als Prohibitionsdilemma bekannte Phänomen führt zu einer Situation, in der Regulierungsmaßnahmen, die dem Spielerschutz dienen sollen, letztlich kontraproduktiv wirken können. Doch ist dieses Dilemma im Kontext des deutschen Glücksspielwesens tatsächlich präsent oder lediglich ein theoretisches Konstrukt ohne echte Substanz? Und welche Konsequenzen hat dies für das im Glücksspielstaatsvertrag verankerte Kanalisierungsziel als Voraussetzung für wirksamen Spieler- und Jugendschutz?
Der Glücksspielstaatsvertrag (§ 1 Satz 1 Nr. 2) verfolgt explizit das Ziel, das natürliche Spielbedürfnis der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken.1 Diese Kanalisierung muss zumindest aus ökonomischer Sicht als übergeordnetes Ziel der Regulierung verstanden werden, da nur im legalen Markt effektive Spieler- und Jugendschutzmaßnahmen überhaupt greifen können. Juristisch mögen die Ziele gleichberechtigt sein. Wie jedoch Spieler- und Jugendschutz gewährleistet werden können, wenn Spieler nicht im legalen, sondern „unkanalisiert“ im illegalen Markt spielen, muss dann ein Rätsel bleiben. Die Kanalisierung ist somit keine bloße theoretische Option, sondern in der praktischen Realität die notwendige Voraussetzung für jeden wirksamen Spieler- und Jugendschutz.
Dabei gilt es die richtige Balance zu finden. Auf der einen Seite soll das Spiel nicht zu attraktiv gestaltet werden, um nicht Individuen überhaupt erst zum Glücksspiel zu animieren oder Spieler mit problematischem Spielverhalten weiter zum exzessiven Spielen zu verleiten. Auf der anderen Seite darf das Spiel aber auch nicht so unattraktiv sein, dass Spieler lieber im unregulierten Schwarzmarkt spielen. Dieser zweite Aspekt ist in der jüngeren Vergangenheit bei der Weiterentwicklung der Regulierung zunehmend ignoriert worden. So wurde die Regulierung terrestrischer Geldspielgeräte durch den Glücksspielstaatsvertrag 2012 bzw. 2021 sowie die Novellierung der Spielverordnung 2014 kontinuierlich verschärft: Reduzierte Höchsteinsätze und -gewinne, reduzierte Spielfrequenz oder Aufstellbeschränkungen haben das legale Angebot nicht nur quantitativ, sondern auch in der Attraktivität beeinträchtigt.
Die Folgen dieser Maßnahmen sind inzwischen deutlich messbar: Mit dem sukzessiven Auslaufen verschiedener Übergangsregeln seit 2018 sank die Anzahl legaler Geldspielgeräte um mehr als 40 Prozent,2 während der Schwarzmarkt kontinuierlich expandiert und 2024 bereits einen geschätzten Anteil von 38 bis 55 Prozent erreicht.3 Diese Entwicklung wird auch durch die Polizeiliche Kriminalstatistik bestätigt: Die Fälle der erfassten unerlaubten Veranstaltungen von Glücksspiel stiegen von 435 (2018) auf 1.339 (2023), während die Teilnahme an solch illegalen Spielen von 392 auf 1.691 Fälle zunahm – eine mehr als vierfache Steigerung binnen fünf Jahren.4
Die beschriebene Situation untergräbt nicht nur die Kanalisierungsbemühungen, sondern entzieht den Spielern jeglichen Schutz und dem Staat erhebliche Steuereinnahmen. Im unregulierten Schwarzmarkt gelten keinerlei Spieler- oder Jugendschutzmaßnahmen. Das Ergebnis ist paradox: Die verschärfte Regulierung schadet genau jenen, die sie schützen soll.
Glücksspiel ist für viele Konsumenten ein Unterhaltungsprodukt, dessen Attraktivität auch von einem breiten Angebot, der Gewinnerwartung oder auch der Spielfrequenz abhängt. Die aktuellen Regulierungsmaßnahmen haben genau
Das Prohibitionsdilemma erscheint im deutschen Glücksspielwesen nicht nur als theoretisches Konzept, sondern als eine durch Daten gestützte Entwicklung. Die gegenwärtige Regulierungspraxis hat zu einer Marktdynamik geführt, die den eigentlichen Zielen des Glücksspielstaatsvertrages entgegensteht. Um das im Glücksspielstaatsvertrag festgeschriebene Kanalisierungsziel zu erreichen, bedarf es daher eines Paradigmenwechsels: weg von immer restriktiveren Einschränkungen, hin zu einer ausgewogenen Regulierung, die das legale Angebot attraktiv genug hält, um das illegale Angebot zurückzudrängen. Eine solche Reform würde keineswegs den Spielerschutz opfern. Im Gegenteil: Eine erfolgreiche Kanalisierung würde mehr Spieler in das regulierte Angebote zurückholen, wo Schutzmaßnahmen überhaupt erst greifen können. Das Verständnis, dass Kanalisierung die unabdingbare Voraussetzung für jede Form von wirksamem Spieler- und Jugendschutz darstellt, muss dabei regulatorischer Leitgedanke sein.
Prof. Dr. Justus Haucap, Düsseldorf*
| 1 | Vgl. Glücksspielstaatsvertrag 2021, verfügbar unter: https://gluecksspiel-behoerde.de/images/pdf/201029_Gluecksspielstaatsvertrag_2021.pdf. |
| 2 | Vgl. Arbeitskreis gegen Spielsucht e. V. (2018), Angebotsstruktur der Spielhallen und Geldspielgeräte in Deutschland; IW Consult (2025), Angebotsstruktur der Spielhallen und Geldspielgeräte in Deutschland. |
| 3 | Vgl. Fritz, D., J. Haucap und S. Thorwarth, Entwicklung der Kanalisierungsquote des gewerblichen Automatenspiels in Deutschland, 2023, S. 36. |
| 4 | Vgl. Bewersdorff, ZfWG 2025, Heft 1, S. 10. |
| * | Auf Seite III erfahren Sie mehr über den Autor. |