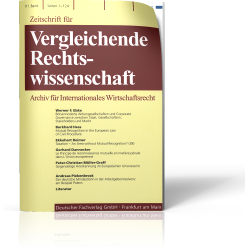Kleine und mittlere Unternehmen im Aufwind der Globalisierung
Von Werner F. Ebke, Heidelberg
I. KMU im Blickpunkt der Europäische Union
Seit dem 1. 1. 2005 gilt in der Europäischen Union eine neue Definition der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Die Empfehlung der Europäischen Kommission vom 6. 5. 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (2003/361/EG)1 ersetzt seit dem 1. 1. 2005 die Empfehlung 96/280/EG der Kommission vom 3. 4. 1996 betreffend die Definition der kleinen und mittleren Unternehmen2. Ziel der Empfehlung 96/280/EG war es, das Nebeneinander verschiedener Definitionen auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten und die sich daraus ergebenden Inkohärenzen zu vermeiden und im Rahmen eines Gemeinsamen Marktes ohne Binnengrenzen für die Behandlung von KMU einen Grundstock an gemeinsamen Regeln zu schaffen. Die Verwendung einheitlicher Regeln durch die Kommission, die Mitgliedstaaten, die Europäische Investitionsbank (EIB) und den Europäischen Investitionsfonds (EIF) sollte die Kohärenz und Effizienz aller politischen Maßnahmen zugunsten der KMU steigern und auf diese Weise die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen mindern. Die im Anhang zu der Empfehlung enthaltene Definition der KMU wurde u.a. in die Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. 1. 2001 über die Anwendung der Art. 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen auf kleine und mittlere Unternehmen übernommen3. Die Mitgliedstaaten wandten die Empfehlung 96/280/EG weit gehend an. Bei der Auslegung und Anwendung der Empfehlung 96/280/EG tauchte allerdings eine Reihe von Fragen auf, die die Kommission schließlich veranlassten, ihre Empfehlung aus dem Jahre 1996 durch die Empfehlung 2003/361/EG zu ersetzen.
Die neue Empfehlung hält an dem Kriterium der Mitarbeiterzahl als einem aussagekräftigen Merkmal zur Definition von KMU fest. Hinzu kommen finanzielle Kriterien, namentlich Umsatzzahlen und Bilanzsumme. Wie schon
Nach der Empfehlung 2003/361/EG gelten als KMU Unternehmen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft. Innerhalb der KMU wird als kleines Unternehmen ein Unternehmen definiert, das weniger als 50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt. Als Kleinstunternehmen gilt ein Unternehmen, das weniger als 10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet. Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu gehören insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Handel, Handwerk, Dienstleistungen und Produktion. Die finanziellen Schwellenwerte (Umsatz bzw. Bilanzsumme) sind in der Empfehlung 2003/361/EG entsprechend den Preis- und Produktivitätsentwicklungen angepasst worden. Die Schwellenwerte für die Anzahl der Mitarbeiter sind dagegen unverändert geblieben. Allerdings wurden die Kriterien für die dabei zu berücksichtigenden Mitarbeiter konkretisiert. So gehen Auszubildende und Studierende in der praktischen Berufsausbildung in die Berechnung der Schwellenwerte nicht mehr ein, um die Berufsausübung zu fördern. Durch die Erweiterung der Befreiung von Forschungseinrichtungen und Risikokapitalfonds sollen die Eigenkapitalfinanzierung und die Forschung und Entwicklung (F&E) seitens der KMU gefördert werden5.
II. Bedeutung der KMU
Was man als reine „Begrifflichkeiten“ oder „technische Details“ abzutun geneigt sein könnte, ist in Wahrheit Ausdruck der Erkenntnis, dass KMU wegen ihrer Flexibilität und Innovationskraft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) eine herausragende Bedeutung haben. KMU stellen heute 99% aller Unternehmen in der EU dar; sie bieten in der EU ca. 65 Millionen Arbeitsplätze. KMU spielen aber nicht nur für die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, sondern auch für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft eine wichtige Rolle. Die meisten KMU werden auch in Zukunft ihre wirtschaftliche Betätigung in erster Linie an ihrem regionalen und nationalen Umfeld ausrichten. Dennoch sind KMU von den Auswirkungen der Globalisierung, ihren Chancen und Risiken unmittelbar beeinflusst6. Die starken Veränderungen der Güter-, Dienstleistungs-, Arbeits- und Kapitalmärkte infolge der zunehmenden Liberalisierung, grenzüberschreitenden Vernetzung und informationstechnologischen Fortschritte führen zu einer Internationalisierung und verlangen auch von den KMU Marktanpassungen und Strategien, die immer häufiger über die heimischen Märkte hinausgehen7. Immer mehr kleine und mittelgroße Unternehmen werden sich in Zukunft stärker als bisher auf die internationalen Märkte zu bewegen. Ein going international kann für die KMU zu einem existenziellen Faktor werden8.
Ein going international bedeutet für ein KMU zunächst, dass es seine Unternehmensaktivitäten über die Grenzen des heimischen Marktes hinaus auf fremde, ausländische Märkte ausdehnt. Am Anfang stehen meist klassische Export-Lieferbeziehungen. Für den nachhaltigen Erfolg eines KMU reicht der bloße Export fertiger Güter im Allgemeinen aber schon bald nicht mehr aus. Eine frühzeitige Beschaffung von preisgünstigen Produktbestandteilen zur Fertigung der eigenen Produkte wird zunehmend wichtiger, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Internationale Wettbewerbsfähigkeit erfordert daher auch die Erschließung ausländischer Beschaffungsmärkte (sog. global sourcing). Der intensiver werdende Wettbewerb auf den weltweiten Märkten veranlasst viele KMU schließlich, ihre Forschungs- und
III. Gestaltungsaufgaben des Rechts
Das Recht ist in besonderem Maße gefordert. Denn wirtschaftliche Aktivitäten und Transaktionen zwischen privaten Wirtschaftssubjekten basieren auf rechtlichen Institutionen. Dabei spielt das Wirtschaftsvölkerrecht (z.B. GATT, GATS, TRIPS, WTO, ILO, Weltbank und IWF) als Instrument zur Überwindung einseitiger nationaler Regeln eine immer bedeutendere Rolle11. Die Koordination der verschiedenen völkerrechtlichen Ordnungssysteme, die inhärente Verbindungen mit dem internationalen Handels- und Wirtschaftsverkehr aufweisen, stellt Juristen vor schwierige Aufgaben12. Die zunehmenden internationalen Aktivitäten der KMU fordern darüber hinaus auch das Zivilrecht heraus, dessen Gestaltungskräfte gerade im grenzüberschreitenden Bereich zum Tragen kommen13. Das Internationale Privatrecht löst das nationale materielle Privatrecht aus seiner territorialen Verankerung und Bindung und eröffnet ihm die Möglichkeit universeller Geltung oder zumindest univer¬
IV. Beispiel: Niederlassungsfreiheit
Die europarechtlich gewährleistete Niederlassungsfreiheit der Gesellschaften (Art. 43 und 48 EG) hat auch und gerade KMU einen Zuwachs an Rechtswahlfreiheit gebracht. Seit der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Überseering sind die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, in einem anderen Mitgliedstaat wirksam gegründete und fortbestehende Gesellschaften als ausländische Gesellschaften anzuerkennen, selbst wenn sich ihr effektiver Verwaltungssitz (siège réel) in einem anderen Mitgliedstaat befindet22. Ein Statutenwechsel, wie ihn die deutsche Version der Sitztheorie traditionell für den Fall der Verlegung des effektiven Verwaltungssitzes aus dem Gründungsstaat in das Inland (Zuzug) fordert, ist danach jedenfalls im Hinblick auf Gesellschaften im Sinne des Art. 48 EG mit der europarechtlich gewährleisteten Niederlassungsfreiheit der Gesellschaften nicht vereinbar. Im Lichte der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Centros gilt Entsprechendes, wenn die betreffende Gesellschaft bereits im Zuge ihrer Gründung ihren tatsächlichen Verwaltungssitz nicht im Gründungsstaat, sondern in einem anderen EU-Mitgliedstaat nimmt23. Für den umgekehrten Fall der Verlegung des effektiven Verwaltungssitzes von Deutschland in einen anderen EU-Mitgliedstaat (Wegzug) dürften niederlassungsrechtlich ähnliche Grundsätze wie für den Zuzug gelten24. Natürlich ist die Versuchung groß, eine Gesellschaft, die zu ihrem Gründungsstaat über das formale Band der Gründung hinaus über keine tatsächlichen, effektiven Beziehungen („genuine link“) verfügt und ihre geschäftlichen Aktivitäten allein oder nahezu ausschließlich in einem anderen EU-Mitgliedstaat (Sitzstaat) entfaltet, zum Schutze der (tatsächlichen oder vermeintlichen) Interessen von Anlegern, Arbeitnehmern, Gläubigern oder sonstigen Stakeholders mit Hilfe von Sonderanknüpfungen nationalen Regeln des Sitzstaates zu unterwerfen. Die Gesetzgeber der US-Bundesstaaten Kalifornien und New York haben dafür eindrückliche gesetzliche Vorlagen geliefert25. Ähnlichen Versuchen des niederländischen Gesetzgebers hat der EuGH in der Rechtssache Inspire Art aus niederlassungsrechtlichen Gründen für die EU aber einen Riegel vorgeschoben26.
Die Rechtsprechung des EuGH zur europarechtlichen Niederlassungsfreiheit hat inzwischen auch Auswirkungen auf Gesellschaften aus Dritt¬
Ob KMU von der neuen Rechtswahlfreiheit im Gesellschaftsrecht im großen Stile Gebrauch machen werden, bleibt abzuwarten. Immerhin sind mit der Gründung einer Gesellschaft im Ausland Pflichten, Kosten und Unwäg¬
V. Komplexe und dynamische Prozesse
KMU sind wesentliche Bestandteile der komplexen und dynamischen Prozesse einer zunehmend international ausgerichteten Wirtschaft. Die Schwierigkeiten, in einer Wirtschaft der globalen Märkte Distanzen, Zeit und Kulturen zu überwinden, dürfen nicht unterschätzt werden – am wenigsten von den KMU selbst. Für Juristen gilt: Wenn sich wirtschaftliche Beziehungen globaisieren, kann das Recht nicht in nationalen Kategorien stecken bleiben. Wir können nicht global wirtschaften und allein national regeln. Nichts zeigt dies deutlicher als das von vielen KMU eingesetzte Internet, das mit seiner beispiellosen Unmittelbarkeit, Flexibilität und Interaktion traditionelle Rechtskonzepte wie das Territorialitätsprinzip und überkommene Regelungs-, Entscheidungs- und Durchsetzungszuständigkeiten an ihre Grenzen stoßen lässt. Auf die Globalisierung gibt es im Recht keine einfachen Antworten. Das gilt auch für die rechtliche Erfassung der Folgen der Internationalisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten der KMU. Die Regelgeber auf nationaler, supranationaler und internationaler Ebene haben jedoch zahlreiche Optionen für
| 1 | ABl. L 124 vom 20. 5. 2003, S. 36. |
| 2 | ABl. L 107 vom 30. 4. 1996, S. 4. |
| 3 | ABl. L 10 vom 13. 1. 2001, S. 33. |
| 4 | Richtlinie 83/349/EWG vom 13. 6. 1983, ABl. L 193 vom 18. 7. 1983, S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/65/EG, ABl. L 283 vom 27. 10. 2001, S. 28. Siehe dazu zuletzt Grundmann, Europäisches Gesellschaftsrecht, 2004, S. 262–271. Zu den Vorschriften über den Konzernabschluss siehe ferner Baetge/Kirsch/Thiele, Konzernbilanzen, 7. Aufl., 2004, S. 18–33. |
| 5 | Ein Muster für eine Erklärung über die zur Einstufung als KMU erforderlichen Angaben findet sich in ABl. C 118 vom 20. 5. 2003, S. 5, berichtigt ABl. C 156 vom 4. 7. 2003, S. 14. |
| 6 | Globalisierung bedeutet das Entstehen weltweiter Beziehungen, aber auch wechselseitiger Beeinflussungen und Abhängigkeiten in wirtschaftlicher, sozialer, politischer, ökologischer, rechtlicher und kultureller Hinsicht. Die dabei entstehende Globalität begründet die Existenz weltumspannender offener Systeme. Einzelne Subsysteme (z.B. Nationen oder supranationale Staatenbündnisse) bilden nicht länger geschlossene isolierte Wirtschaftsräume, sondern sind durch interdependente Beziehungen dauerhaft und unumkehrbar miteinander verknüpft. Siehe nur Beck, Was ist Globalisierung?, 1997, S. 27ff. |
| 7 | Ebke, Going International von kleinen und mittleren Unternehmen, RIW 2004, 241. |
| 8 | Eden, Kleine und mittlere Unternehmen im Prozess der Internationalisierung, in: Krystek/Zur (Hrsg.), Handbuch Internationalisierung. Globalisierung als Herausforderung für die Unternehmensführung, 2. Aufl. 2002, S. 35–80. |
| 9 | Ebke, KMU und Globalisierung, in: Girsberger/Schmidt (Hrsg.), Rechtsfragen rund um die KMU, 2003, S. 175, 194–195. |
| 10 | Das Gesamtbudget für das 6. Europäische Forschungsrahmenprogramm beläuft sich auf 17,5 Mrd. EUR, was einer Steigerung um rd. 17% im Vergleich zum 5. Rahmenprogramm bedeutet. |
| 11 | Wie sich nationale Eigeninteressen (teilweise erfolgreich) gegen die Vorgaben des Wirtschaftsvölkerrechts durchzusetzen versuchen, zeigt sich am Beispiel des Art. VIII Abschn. 2(b) IWF-Übereinkommen: Ebke, Sir Joseph Gold and the International Law of Exchange Controls, 35 Int’l Law. 1475, 1482–1485 (2001). |
| 12 | Siehe nur Neumann, Die Koordination des WTO-Rechts mit anderen völkerrechtlichen Ordnungen, 2002. |
| 13 | Nach wie vor wegweisend Großfeld, Zivilrecht als Gestaltungsaufgabe, 1977. |
| 14 | Schnyder; Wirtschaftskollisionsrecht, 1990; Habermeier, Neue Wege zum Wirtschaftskollisionsrecht, 1997. |
| 15 | Behrens, Die Bedeutung des Kollisionsrechts für die „Globalisierung“ der Wirtschaft, in: Basedow/Drobnig/Ellger/Hopt/Kötz/Kulms/Mestmäcker (Hrsg.), Aufbruch nach Europa, 75 Jahre Max-Planck-Institut für Privatrecht, 2001, S. 381, 397. |
| 16 | Girsberger, KMU und Streiterledigung: Traditionelles und Alternatives, in: Girsberger/Schmid (Hrsg.), Rechtsfragen rund um die KMU, 2003, S. 35. |
| 17 | Ebke, Märkte machen Recht – auch Gesellschafts- und Unternehmensrecht!, in: FS Lutter, 2000, S. 17. Zur Funktionsfähigkeit eines Wettbewerbs der Rechtsordnungen im Europäischen Gesellschaftsrecht siehe Heine, Regulierungswettbewerb im Gesellschaftsrecht, 2003. |
| 18 | Nach dem Bilanzrechtsreformgesetz vom 4. 12. 2004, BGBl. 2004 I 3166, müssen Einzelabschlüsse grundsätzlich nicht nach IFRS aufgestellt werden. KMU, die sich international um Kapital bemühen, werden es aber als Vorteil ansehen, IFRS anzuwenden, auch wenn sie nicht börsennotiert sind. |
| 19 | Siehe den am 1. 7. 2004 vom Hauptfachausschuss des IDW verabschiedeten IDW Prüfungshinweis: Besonderheiten der Abschlussprüfung kleiner und mittlerer Unternehmen (IDW PH 9.100.1), abgedruckt in WPg 2004, 1038. Zu Einzelheiten siehe Siebert, Zur Anwendung der IDW Prüfungsstandards auf die Abschlussprüfung kleiner und mittelgroßer Unternehmen, WPg 2004, 973. |
| 20 | Fehrenbacher, Registerpublizität und Haftung im Zivilrecht, 2004, S. 287–318; Hellermann, Die Publizität des Jahresabschlusses geschlossener Kapitalgesellschaften, 2004. |
| 21 | Ebke, Unternehmenskontrolle durch Gesellschafter und Markt, in: Sandrock/Jäger (Hrsg.), Internationale Unternehmenskontrolle und Unternehmenskultur, 1994, S. 7, 24–25. |
| 22 | EuGH 5. 11. 2002 – Rs. C-208/00, Slg. 2002, I-9919 = RIW 2002, 954. |
| 23 | EuGH 9. 3. 1999 – Rs. C-212/97, Slg. 1999, I-1459 = RIW 1999, 447. |
| 24 | Sandrock, Was ist erreicht? Was bleibt zu tun? Eine kollisions- und materiellrechtliche Bilanz, in: Sandrock/Wetzler (Hrsg.) Deutsches Gesellschaftsrecht im Wettbewerb der Rechtsordnungen, 2004, S. 33, 89–96; Ebke, Überseering: „Die wahre Liberalität ist Anerkennung“, JZ 2003, 927, 932. |
| 25 | Siehe dazu rechtsvergleichend Ebke, The European Conflict-of-Corporate-Laws Revolution: Überseering, Inspire Art and Beyond, Eur.Bus.L.Rev. 2004, 1497, 1518–1519. |
| 26 | EuGH 30. 9. 2003 – Rs. C-167/01, Slg. 2003, I-10155 = RIW 2003, 957. |
| 27 | Zur Drittstaatsproblematik siehe Ebke, Überseering und Inspire Art: Auswirkungen auf das Internationale Gesellschaftsrecht aus der Sicht von Drittstaaten, in: Sandrock/Wetzler (Hrsg.), Deutsches Gesellschaftsrecht im Wettbewerb der Rechtsordnungen, 2004, S. 101, 109–128; Trüten, Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Anerkennung von Gesellschaften und ihre Auswirkungen auf die Schweiz, 2001. |
| 28 | BGH, RIW 2004, 787 = BB 2004, 1868 mit Anm. Mellert. Zu Einzelheiten der Entscheidung siehe Ebke, Gesellschaften aus Delaware auf dem Vormarsch: Der BGH macht es möglich, RIW 2004, 740. |
| 29 | BGHZ 153, 353 = RIW 2003, 473. Siehe auch BGH WM 2002, 1186 (betr. limited partnership New Yorker Rechts). Zu Einzelheiten des Urteils des VIII. Zivilsenats siehe Dammann, Amerikanische Gesellschaften mit Sitz in Deutschland, RabelsZ 68 (2004) 607. |
| 30 | BGBl. 1956 II 487. |
| 31 | BGH, BB 2004, 2595 mit BB-Kommentar Elsing. |
| 32 | BGH, BB 2004, 2595, 2596; ebenso schon BGH, RIW 2004, 787 (r.Sp.). |
| 33 | Zur Bedeutung der europarechtlichen Niederlassungsfreiheit im Verhältnis zu Gesellschaften aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (Liechtenstein, Island und Norwegen) siehe OLG Frankfurt a. M., IPRax 2004, 56 mit Bespr.-Aufsatz Baudenbacher/Buschle, IPRax 2004, 236. |
| 34 | Siehe dazu ausführlich Rehm, in: Eidenmüller (Hrsg.), Ausländische Kapitalgesellschaften im deutschen Recht, 2004, S. 14ff. |
| 35 | Zur Bedeutung des GATS in diesem Zusammenhang siehe Lehmann, Fällt die Sitztheorie jetzt auch international?, RIW 2004, 816. Zur EMRK siehe Ebke (Fn. 27), S. 114–115 m.w.Nachw. |
| 36 | Zu den British Virgin Islands siehe BGH, RIW 2004, 937. |
| 37 | Ebke, Wirtschaft und Recht im Zeichen der Globalisierung, in: FS Druey, 2002, S. 99, 112–113. |